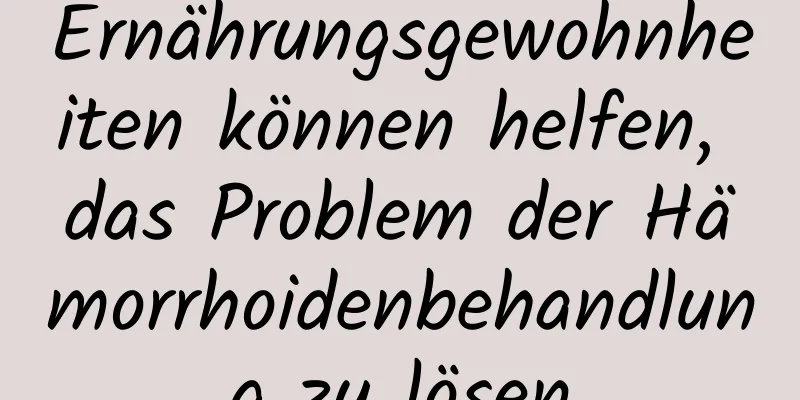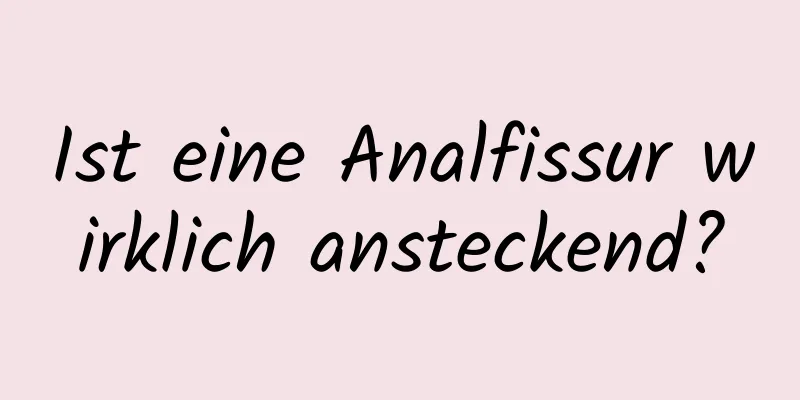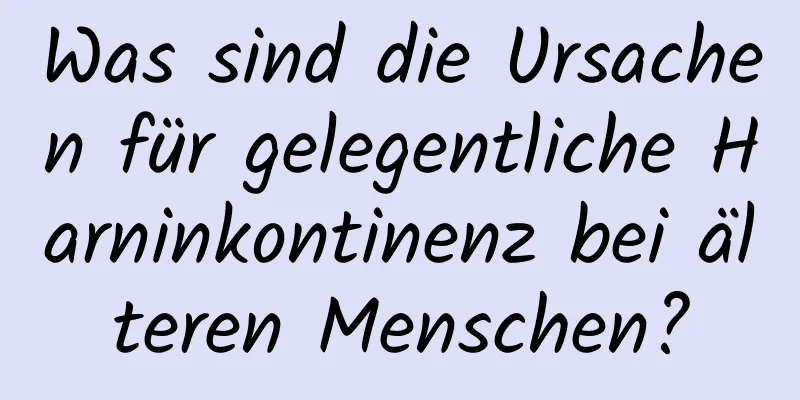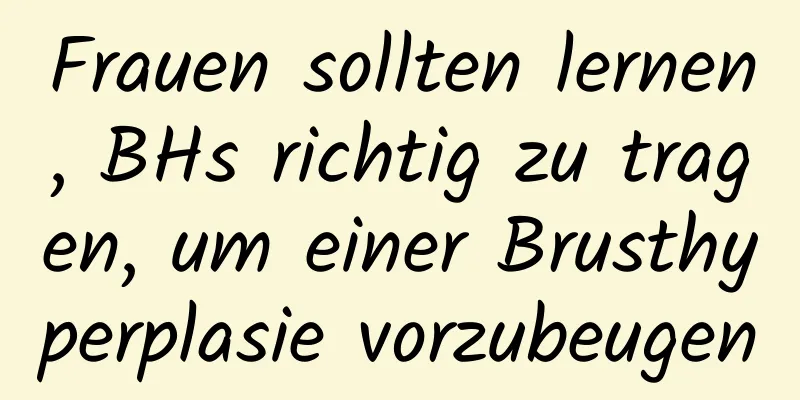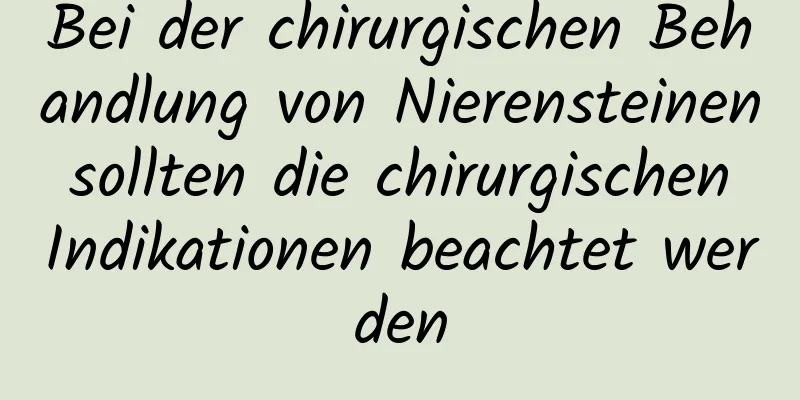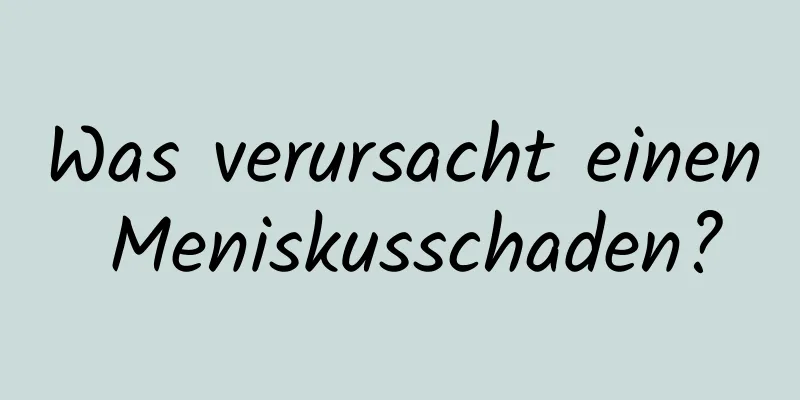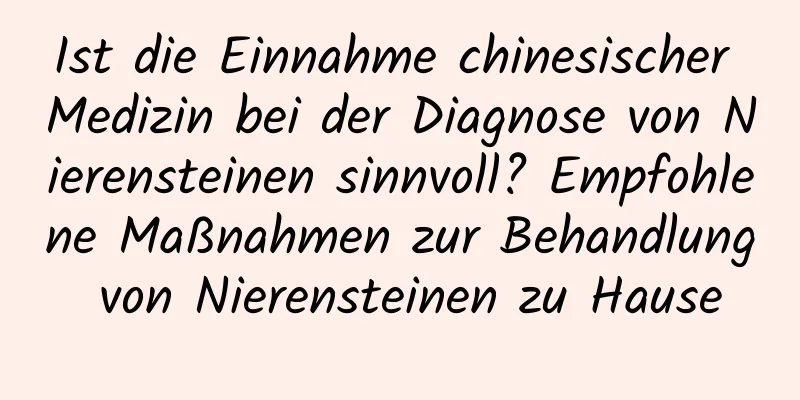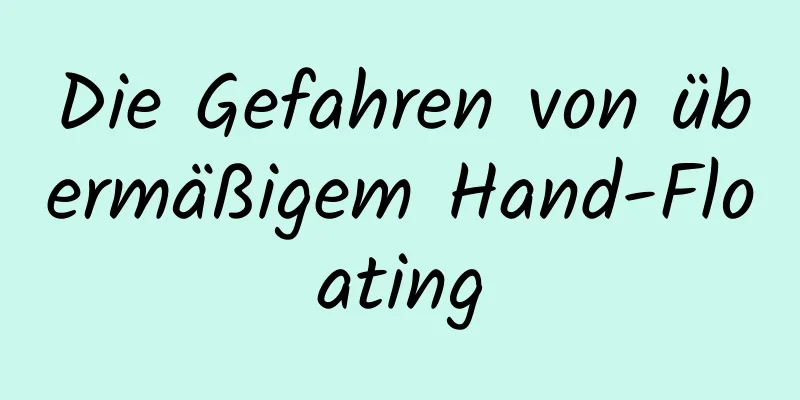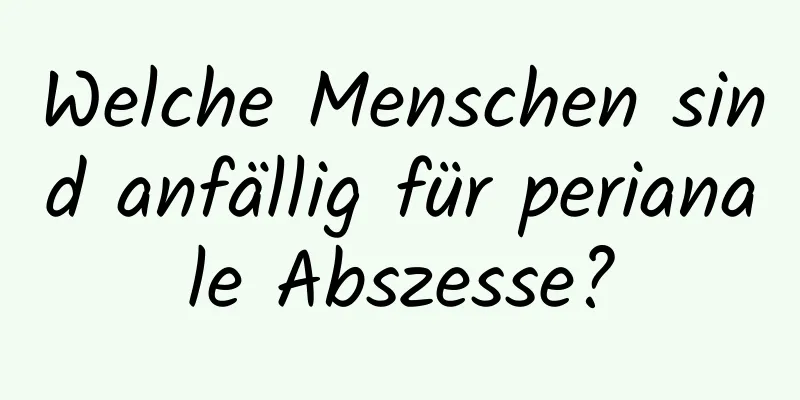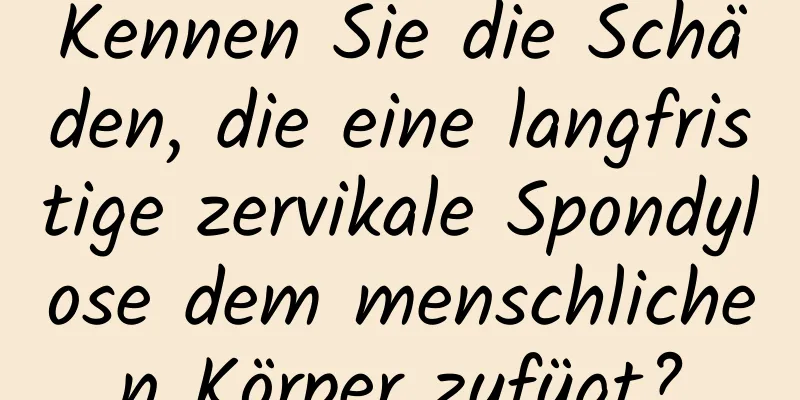Cystitis glandularis: eine einfache Krankheit?
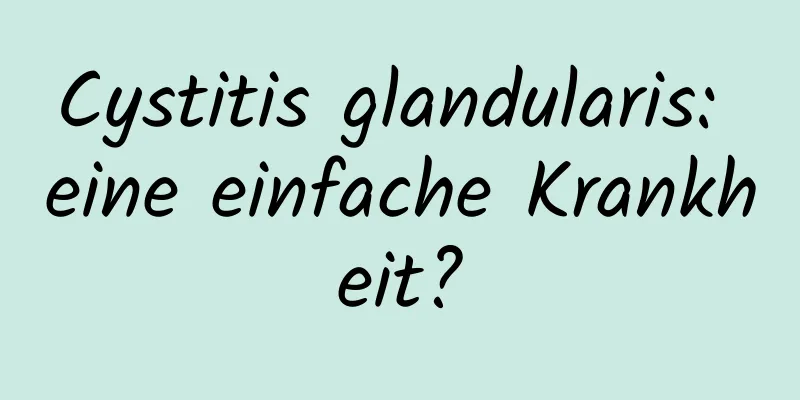
|
1. Ist die Drüsenzystitis eine häufige Erkrankung? Seit Stoerck 1899 erstmals darüber berichtete, wird die Drüsenzystitis von Urologen und Pathologen zunehmend ernst genommen. Die Zahl der Meldungen hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen, es handelt sich jedoch nicht unbedingt um eine häufige Erkrankung. Autoritative Bücher wie „Urology“ von Campell und „Urology“ von Wu Jieping enthalten keine eigenständigen Kapitel, in denen diese Krankheit vorgestellt wird, und erwähnen sie nur im Zusammenhang mit Urotheltumoren. In Büchern zur Pathologie finden sich häufig ausführlichere Beschreibungen, meist zu diagnostischen Merkmalen, während Berichte zu klinischen Manifestationen und Behandlungen häufig in klinischen Artikeln zu finden sind. Bei der Suche nach „cystisglandularis“ oder „cystiscystica“ im Artikeltitel in Medline wurden nur 101 relevante Artikel gefunden, während es 695 chinesische Artikel (1994–2010) gab. Es mangelt an Forschung zur Inzidenz und Prävalenz dieser Krankheit. Die Prävalenz einer klinisch manifesten Glandularzystitis in der US-Bevölkerung liegt Berichten zufolge bei 0,9–1,9 %. Weiner et al. berichteten über 100 Autopsiefälle makroskopisch normaler Blasen, bei denen in 89 % bzw. 60 % Brunn-Nester und glanduläre Zystitis festgestellt wurden. Eine glanduläre Zystitis kann in jeder Altersgruppe auftreten, kommt jedoch häufiger bei Frauen und seltener bei Kindern vor. Gong Daxin, Abteilung für Urologie, das erste angeschlossene Krankenhaus der China Medical University Handelt es sich bei Brunn-Nest, Cystitis cystica und Cystitis glandularis um dieselbe Erkrankung? Brunn-Nest (manchmal auch Von-Brunn-Nest genannt), Cystitis cystica und Cystitis glandularis sind drei häufige proliferative Läsionen der Blasenschleimhaut. Die drei Symptome stehen in Wechselwirkung und treten häufig im Zusammenhang mit entzündlichen Blasenerkrankungen sowie gut- und bösartigen Tumoren auf. Einige Studien haben auch gezeigt, dass die glanduläre Zystitis eine Läsion ist, bei der Hyperplasie und Metaplasie gleichzeitig auftreten. Von-Brunn-Nester entstehen, wenn das Übergangsepithel der Blase unter der Schleimhaut knospenartig wächst, wenn es verschiedenen chronischen Reizen ausgesetzt ist. Anschließend wird es vom umgebenden Bindegewebe umgeben und geteilt und vom Übergangsepithel getrennt, sodass eine nestartige Struktur entsteht. Von Brunns Nester bestehen aus gut differenziertem Übergangsepithel, wobei die Epithelzellen senkrecht zur umgebenden Basalmembran angeordnet sind. Manchmal wird das Zentrum des Epithelnestes zystisch. Wenn die Zystenhöhle mit Übergangsepithel bedeckt ist und die Flüssigkeit in der Zyste hellgelber Schleim ist, spricht man von einer Zystenzystitis. In der Lamina propria sind Drüsenbildungen zu erkennen und manchmal kann das luminale Epithel eine weitere Metaplasie in schleimiges Zylinderepithel ähnlich der Darmschleimhaut hervorrufen. Gleichzeitig kommt es zur Infiltration von Lymphozyten und Plasmazellen. Eine histologische Analyse zeigt, dass die Drüsen darmartigen Schleim absondern, was als Drüsenzystitis bezeichnet wird. In einigen Fällen kann Darmschleim über den Urin ausgeschieden werden. In den meisten Fällen treten gleichzeitig Von-Brunn-Nester, zystische Metaplasie und glanduläre Metaplasie auf, die zusammenfassend als glanduläre Zystitis oder zystische glanduläre Zystitis bezeichnet werden. Diese proliferativen Läsionen können auch in den Harnleitern oder im Nierenbecken auftreten. Die polypoide Zystitis wird durch exophytisches Wachstum des Übergangsepithels verursacht. Es gibt zwei Arten der glandulären Zystitis: die klassische und die intestinale Zystitis, wobei letztere weniger häufig vorkommt. Der typische Typ bezieht sich auf Drüsen, die aus kubischem Epithel und Zylinderepithel bestehen und mit mehreren Schichten Übergangsepithel der Harnwege bedeckt sind. Beim intestinalen Typ bestehen die Drüsen aus schleimabsonderndem Zylinderepithel mit Kernen an der Basis; häufig sind Becherzellen zu sehen. Einige Wissenschaftler unterteilen es auch in vier Typen: Übergangszelltyp, Darmepitheltyp, Prostataepitheltyp und gemischter Typ. 3. Ist die Ursache der Drüsenzystitis klar? In der Literatur wird größtenteils davon ausgegangen, dass Drüsenzystitis durch eine langfristige Stimulation einer chronischen Entzündung verursacht wird, wie etwa durch die langfristige Stimulation von Steinen, Infektionen, Obstruktionen, Katheterisierung der Harnwege, Tumoren und andere Faktoren. Parker et al. Es wurden 32 Fälle von Zystitis cystica und 8 Fälle von Drüsenzystitis gemeldet, bei 95 % davon traten Infektions-, Stein- und Obstruktionsfaktoren auf. Delnay et al. berichteten, dass etwa 23 % der Patienten mit Harnkatheterisierung Symptome einer Drüsenzystitis hatten. Allerdings gibt es auch Literaturberichte, denen zufolge bei etwa 25 % der Patienten keine offensichtlichen prädisponierenden Faktoren vorliegen. Kaplan und King berichteten von einer glandulären Zystitis bei 2,4 % der Kinder mit wiederkehrenden Harnwegsinfektionen. Es kommt häufiger bei Mädchen vor und einige Patienten leiden auch an vesikoureteralem Reflux. Eine andere Ansicht ist, dass die Drüsenzystitis durch eine abnormale Embryonalentwicklung verursacht wird. Während der Embryonalentwicklung wird die Kloake in den Urogenitalsinus und den Mastdarm unterteilt. Durch die Trennung von Rektum und Urogenitalsinus bleiben Reste des Urachus bzw. Darmepithels zurück, was schließlich zur Entstehung einer Drüsenzystitis führt. Einige Wissenschaftler sind damit auch nicht einverstanden, da glanduläre Ureteritis und glanduläre Pyelitis auch im Harnleiter und Nierenbecken auftreten können. Andere mögliche Ursachen sind Vitaminmangel, allergische Reaktionen auf Giftstoffe, Virusinfektionen, Karzinogene, IgA-vermittelte Immunreaktionen und Hormonstörungen. Etwa 75 % der Patienten mit Beckenlipomatose leiden an einer Drüsenzystitis, und der Mechanismus muss noch weiter erforscht werden. 4. Ist die glanduläre Zystitis eine präkanzeröse Läsion? Angesichts der Tatsache, dass 50–100 % der bei Autopsien entnommenen Blasen Brunn-Nester, Zystitis cystica und andere Manifestationen in unterschiedlichem Ausmaß aufweisen, gehen einige Wissenschaftler davon aus, dass es sich bei den oben genannten histologischen Veränderungen eher um normale Variationen der Blasenschleimhaut als um präkanzeröse Läsionen handeln könnte. Es ist bemerkenswert, dass diese Autopsieblasen im Großen und Ganzen normal waren und nur mikroskopische histologische Veränderungen aufwiesen. Die meisten Forscher gehen davon aus, dass es sich bei der glandulären Zystitis um eine präkanzeröse Läsion handelt, die mit einem Adenokarzinom der Blase in Zusammenhang steht. Ein Adenokarzinom des Trigonums entsteht häufig im Rahmen einer Glandularzystitis oder einer Cystitis cystica. Eine Glandular-Zystitis tritt häufig im Umfeld eines Carcinoma in situ oder anderer invasiver Blasentumore auf. In fünf großen Fallserien von Blasenadenokarzinomen lag in etwa 10 % bis 42 % der Fälle eine Glandularzystitis vor. Slmon et al. untersuchten 38 vollständig resezierte Blasenkrebsproben und stellten fest, dass atypische Hyperplasie, Zystitis cystica und Brunn-Nester 89 % der Fälle ausmachten. Sie gingen davon aus, dass zwischen den beiden Arten von Blasenkrebsproben drei mögliche Zusammenhänge bestehen: (1) Vor dem Tumor bestanden muzinöse hyperplastische Veränderungen; (2) beides geschah gleichzeitig; und (3) der Tumor vor den muzinösen hyperplastischen Veränderungen auftrat. Einige Wissenschaftler haben daher folgende Hypothese aufgestellt: Möglicherweise führt die Stimulation des Tumors zur Dysplasie der Blasenschleimhaut und zur Bildung einer Drüsenentzündung im Tumorbereich und im umliegenden Gewebe, oder es handelt sich um eine maligne Transformation auf der Grundlage einer Drüsenzystitis. Angesichts der oben genannten Kontroversen sind einige Wissenschaftler der Ansicht, dass diffuse makroskopische Läsionen, weitverbreitete Zellnester in der Histologie und molekularbiologische Indikatoren, die auf eine aktive proliferative glanduläre Zystitis hindeuten, ein hohes Risiko für eine Krebsentstehung bergen und als präkanzeröse Läsionen betrachtet werden sollten. Lu et al. fanden heraus, dass Bcl-2 bei Patienten mit Drüsenzystitis stark exprimiert wurde und mit der Karzinogenese in Verbindung stand. Zhou Xing et al. berichteten, dass die Expressionsrate von Ras- und p21-positiven Proteinen bei Patienten mit Drüsenzystitis bis zu 70,5 % betrug, von denen 42,5 % bösartig wurden. Sie glaubten, dass die hohe Expression von Ras und P21 ein Zeichen für die beginnende maligne Transformation einer Drüsenzystitis sein könnte. Murphy et al. fanden heraus, dass mAbDas1 die Möglichkeit einer malignen Transformation einer Drüsenzystitis vorhersagen kann. Solche Patienten sollten engmaschig beobachtet und regelmäßig nachuntersucht werden (einschließlich Urinzytologie, Zystoskopie und Biopsie). Studien haben ergeben, dass die Dauer der Giftbelastung, der Krankheitsverlauf, Blasensteine und Schwierigkeiten beim Wasserlassen ebenfalls wichtige Risikofaktoren für Krebs sein können. Der Grund für die oben genannte Kontroverse könnte darin liegen, dass es derzeit kein anerkanntes einheitliches Verständnis von präkanzerösen Läsionen gibt. In der Pathologie geht man davon aus, dass sich präkanzeröse Läsionen auf Läsionen beziehen, die vor bösartigen Tumoren auftreten und in ihrer Morphologie einen gewissen Grad an atypischer Hyperplasie aufweisen, selbst jedoch keine bösartigen charakteristischen Veränderungen aufweisen oder als bestimmte Läsionen gelten, bei denen die Wahrscheinlichkeit einer Krebsentwicklung höher ist. Die WHO legt fest, dass verschiedene Läsionen, bei denen die Wahrscheinlichkeit einer bösartigen Entwicklung 20 % übersteigt, als präkanzeröse Läsionen gelten. Die Einstufung einer beliebigen Läsion als präkanzeröse Läsion, also einer Läsion, die das Potenzial hat, sich zu Krebs zu entwickeln, unabhängig von ihrer Wahrscheinlichkeit oder der Zeitspanne seit der Krebsentstehung, ist etwas zu allgemein und hat keinen praktischen Wert. Eine chronische Blasenentzündung kann eine Plattenepithel- und eine glanduläre Metaplasie der Blasenschleimhaut verursachen. Die oben genannten pathologischen Veränderungen können sich zu einem Plattenepithelkarzinom oder Adenokarzinom weiterentwickeln. Es ist offensichtlich unvernünftig, eine chronische Blasenentzündung als eine präkanzeröse Läsion zu definieren. Derzeit liegen keine systematischen wissenschaftlichen Langzeitdaten zur Drüsenzystitis vor und die aktuellen Erkenntnisse reichen nicht aus, um nachzuweisen, dass es sich bei jeder histologischen Drüsenzystitis um eine präkanzeröse Läsion handelt. Obwohl sich die Wissenschaft nicht einig ist, dass es sich bei der glandulären Zystitis um eine präkanzeröse Läsion handelt, werden eine aktive Behandlung und sorgfältige Nachsorge anerkannt und empfohlen. Die meisten Berichte deuten darauf hin, dass die glanduläre Zystitis mit Adenokarzinomen in Zusammenhang steht. Es gibt jedoch auch viele Berichte, die darauf hinweisen, dass die glanduläre Zystitis auch mit Urothelkarzinomen und Plattenepithelkarzinomen in Zusammenhang steht. Yu Jianjun et al. berichteten über 104 Patienten mit Glandular-Zystitis, davon 80 mit einfacher Glandular-Zystitis; Bei 11 der 24 Fälle mit Krebsentstehung handelte es sich um eine glanduläre Zystitis, die sich zu einem Urothelkarzinom entwickelte. Kittreze (1964) und Salm (1967) berichteten über einen Fall von glandulärer Zystitis, der gleichzeitig mit einem muzinösen Adenokarzinom der Blase bzw. einem Plattenepithelkarzinom der Blase auftrat. Donald et al. berichteten über zwei Fälle von Drüsenzystitis, begleitet von Blasenadenokarzinom und Urothelkarzinom. Peter Fegen et al. berichteten über drei Fälle von Patienten mit gleichzeitig bestehendem Blasenadenokarzinom und Urothelkarzinom und vermuteten, dass sich die Adenokarzinome möglicherweise aus der Drüsenblase entwickelt haben und die beiden Tumorgewebe sich möglicherweise gemeinsam aus Urothelzellen entwickelt haben. Studien haben gezeigt, dass eine langfristige chronische Entzündung zu Veränderungen der Blasenschleimhaut wie z. B. einer glandulären Zystitis, einer Plattenepithel-Metaplasie und einer vorübergehenden atypischen Hyperplasie führen kann. Daher können die oben genannten Erkrankungen Adenokarzinom, Plattenepithelkarzinom, Urothelkarzinom und Glandularzystitis gleichzeitig vorliegen. Ihre Ursprünge und Beziehungen können äußerst komplex sein. Welches zuerst kommt, bedarf weiterer Diskussion. 5. Ist die Diagnose einer glandulären Zystitis einfach? Die wichtigsten klinischen Manifestationen einer Drüsenzystitis sind häufiges Wasserlassen, Harndrang, Schmerzen beim Wasserlassen, Schmerzen im Unterleib und Damm, Dysurie und mikroskopische Hämaturie. Es kommt häufig im Blasendreieck, am Blasenhals und rund um die Harnleiteröffnung vor. Sie ähnelt anderen unspezifischen Blasenentzündungen und weist keine Spezifität auf. Manche Menschen glauben, dass es bei der Zystoskopie zu charakteristischen Erscheinungen kommt: Die Spitze des Papillentumors ist im Allgemeinen durchscheinend, ohne Gefäßäste, und um die Papille herum sind Ödeme zu sehen, die einzeln oder in Gruppen auftreten können. Tatsächlich treten bei der Drüsenzystitis bei einer zystoskopischen Untersuchung viele verschiedene Erscheinungsformen auf: (1) Typ der papillären Hyperplasie (auch Typ des follikulären Ödems genannt), bei dem die Blasenschleimhaut eine gestielte papilläre Hyperplasie aufweist, die Oberfläche gestaut und ödematös ist und die Stiele unterschiedlich groß sind. (2) Typ der lamellären Hyperplasie: Der Blasenschleim vermehrt sich zottig oder lamellenartig. (3) Chronisch-entzündlicher Typ: Die Blasenschleimhaut weist lokale Stauungen, Rauheit, kleine Erosionen und Follikel auf. (4) Gemischter Typ: Es sind mehrere Typen gleichzeitig vorhanden. Die oben genannten Erscheinungen können leicht mit follikulärer Zystitis, entzündlichem Pseudotumor, eosinophiler Zystitis, interstitieller Zystitis und tuberkulöser Zystitis verwechselt werden, und Fehldiagnosen als Blasenkrebs sind nicht selten. Die charakteristischen Erscheinungsformen sind nur beim papillären Hyperplasie-Typ von gewisser Bedeutung, beim lamellären Hyperplasie-Typ und beim chronisch-entzündlichen Typ hingegen kaum von Bedeutung. Aufgrund der Vielfalt der morphologischen Erscheinungsformen ist es schwierig, anhand bildgebender Untersuchungen wie Ultraschall, CT, MRT und IVU eine spezifische Diagnose zu stellen. Xiao Yajun et al. Bei der Untersuchung der Blase mit akustischem Kontrastmittel B mittels Wasserstoffperoxid wurden 30 Fälle von Blasentumoren und 11 Fälle von Drüsenzystitis beobachtet. Sie stellten fest, dass die Läsionen der Drüsenzystitis keine offensichtlichen Blutungen oder Nekrosen aufwiesen und eine relativ glatte Oberfläche hatten. Nach der Kontrastbildgebung mit Wasserstoffperoxid sind keine winzigen Sauerstoffbläschen mehr vorhanden und es liegt keine offensichtliche Verstärkung der Oberflächenechoreflexion vor, was zur Unterscheidung von Blasentumoren verwendet werden kann, aber sein klinischer Anwendungswert ist begrenzt. Die Diagnose einer Drüsenzystitis basiert hauptsächlich auf einer Kombination aus Zystoskopie und Biopsie. Bei Patienten mit Verdacht auf pathogene Faktoren und klinischen Manifestationen wird empfohlen, sich so bald wie möglich (innerhalb einer Woche) einer Zystoskopie und Biopsie zu unterziehen, vorausgesetzt, dass der Urinablauf normal ist oder keine Infektion vorliegt. So kann eine frühzeitige Diagnose und Behandlung erreicht werden, um eine Verlängerung des Krankheitsverlaufs und eine Verschlechterung der Läsion zu vermeiden. Bei Bedarf kann die pathologische Biopsie mit den Ergebnissen der Immunhistochemie kombiniert werden. 6. Gibt es eine wirksame Behandlung für Drüsenzystitis? Derzeit gibt es keine zufriedenstellende Behandlung für die Drüsenzystitis. Die Rückfallrate einiger Fälle ist hoch. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Behandlungsmethoden mit unterschiedlicher Wirksamkeit. Die erste Wahl besteht in der Beseitigung der Ursache (langfristige Antibiotikabehandlung, Entfernung mechanischer Reize). Auf dieser Grundlage gibt es auch das Stripping der Blasenschleimhaut, die partielle Zystektomie, die totale Zystektomie (kombiniert mit einer Form der Harnableitung), die Blasenvergrößerung, die Harnleiterblasenreimplantation, die intravesikale Instillation verschiedener Medikamente (wie Mitomycin, Thiotepa, Birubicin, Hydroxycamptothecin, 1% Silbernitrat, Procain + Gentamicin und BCG usw. sowie Immunmodulatoren wie Interleukin-2 und Interferon), die transurethrale Elektrokauterisation oder Lasertherapie und die Strahlentherapie. Es gibt auch eine Behandlungsmethode der transurethralen Elektroresektion oder Elektrokauterisation in Kombination mit einer Blaseninstillation. Die allgemeine Infusionsdosis von BCG beträgt 100 mg + 40 ml physiologische Kochsalzlösung. Die Behandlung erfolgt nach der Blasenkrebs-Infusionsmethode, einmal wöchentlich, insgesamt 6-mal. Die Methode der intravesikalen Instillation von Chemotherapeutika ist die gleiche wie bei der Instillation von Blasentumoren. Die Medikamentendosis und der Behandlungsverlauf können je nach Krankheitsverlauf entsprechend angepasst werden. Bei oberflächlichem Übergangszellkarzinom der Blase mit geringem Risiko ist nach der Operation keine intravesikale Instillation erforderlich. Aus diesem Grund sind manche Menschen der Ansicht, dass nach einer transurethralen Resektion keine „Überbehandlung“ durch die intravesikale Instillation von Krebsmedikamenten erforderlich sei. Bei Patienten mit einem Rückfall wird üblicherweise eine Instillation von Medikamenten durchgeführt. Die Infusionsdosis der 1%igen Silbernitratlösung beträgt 40 ml, einmal alle 1 bis 2 Wochen, und eine Behandlungsdauer beträgt ein halbes Jahr. Die Strahlentherapie erfolgt üblicherweise mit einem Linearbeschleuniger mit einer Dosis von 4000 bis 4500 Gy (60 % der Tumorbehandlungsdosis), aufgeteilt auf 16 bis 18 Bestrahlungen, einmal täglich oder jeden zweiten Tag. Die Symptome können nach 3 bis 6 Monaten Behandlung gelindert werden. Da es sich bei der Drüsenzystitis um eine hartnäckige Erkrankung handelt, reichen einige Läsionen tief in die sublaminare Schicht der Blase hinein. Daher sollte während der Elektroresektion und des Verdampfungsprozesses die gesamte erkrankte Schleimhaut und die angrenzende normale Schleimhaut entsprechend der Art der Läsion, der Tiefe und dem Ausmaß der Läsion entfernt werden und die Tiefe sollte bis zur sublaminaren Schicht reichen. Bei Patienten mit ausgedehnten Läsionen wird eine Elektrokauterisation oder Laserbehandlung nicht empfohlen, da es schwierig ist, die Läsionen vollständig zu entfernen, und großflächiges Verbrennen die Symptome einer Blasenreizung verschlimmert. Bei Patienten mit ausgedehnten Blasenläsionen, die das Trigonum und den Blasenhals betreffen, oder bei Patienten mit lokalem Adenokarzinom sollte eine radikale Zystektomie durchgeführt werden. Bei der Entscheidung für eine Operation sollten jedoch das Ausmaß der Läsion, die Schwere der Erkrankung und die zukünftige Lebensqualität des Patienten sorgfältig berücksichtigt werden. Um die therapeutische Wirkung einer Drüsenzystitis zu verbessern, sollten geeignete Behandlungsmethoden (einschließlich der kombinierten Anwendung mehrerer Behandlungsmethoden) auf der Grundlage des Vorhandenseins oder Fehlens eindeutiger auslösender Faktoren, damit verbundener Grunderkrankungen sowie der Art, des Ortes, des Ausmaßes und der Pathologie der Läsionen ausgewählt werden. Bei der Auswahl der Behandlung einer Drüsenzystitis sollten die folgenden Grundsätze beachtet werden: (1) Die Beseitigung der auslösenden Faktoren und die Beseitigung der Grunderkrankung sind die grundlegenden Behandlungsmethoden. Nach diesen Behandlungen können sich einige Patienten von selbst erholen. (2) Die transurethrale Elektroresektion oder Elektrokauterisation ist die Hauptbehandlungsmethode, die für Tumoren größer als 0,5 cm besser geeignet ist. (3) Patienten mit unbekannter Ätiologie und diffusen Läsionen sollten eine intravesikale Chemotherapie erhalten. (4) Patienten mit ausgedehnten Läsionen und aktiver Proliferation sollten überwacht, regelmäßig nachuntersucht und gegebenenfalls wie ein Blasenkrebs behandelt werden. (5) Bei Patienten mit einer langen Anamnese, ausgedehnten Läsionen, schweren Symptomen und einem starken Verdacht auf Malignität oder Bösartigkeit kann eine partielle oder vollständige Zystektomie durchgeführt werden. Eine Zystektomie sollte mit Vorsicht durchgeführt werden. (6) Der kombinierte Einsatz mehrerer Behandlungsmethoden kann den Behandlungseffekt verbessern. |
<<: Wird Hämaturie durch eine Blasenentzündung verursacht?
>>: Experten sprechen über die Korrekturmethode von O-förmigen Beinen
Artikel empfehlen
Welche Behandlungen werden bei zervikaler Spondylose üblicherweise angewendet?
Ich glaube, jeder kennt die zervikale Spondylose,...
Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es für Hydrozephalus?
Welche Methoden gibt es zur Behandlung eines Hydr...
Eltern sollten rechtzeitig auf die Vorbeugung von Rachitis achten
Rachitis ist eine relativ häufige orthopädische E...
Wie man eine Spinalkanalstenose behandelt
Wie sollte eine Spinalkanalstenose behandelt werd...
Beeinträchtigt Harninkontinenz die Lebenserwartung?
Harninkontinenz ist nicht leicht zu heilen, wenn ...
Wie viel kostet die Behandlung einer Kniearthrose?
Bei der Behandlung einer Kniearthrose sind viele ...
Wie behandelt man männliche Urethritis?
Urethritis ist eine Erkrankung der Harnwege, die ...
Der beste Weg, innere Hämorrhoiden zu heilen
Es gibt keine „beste Selbstheilungsmethode für in...
Welche Krankenhäuser eignen sich am besten zur Behandlung eines Leberhämangioms?
Derzeit gibt es viele Krankenhäuser, die auf die ...
Was tun, wenn der Femurkopf nekrotisiert ist?
Patienten, die bereits an einer Femurkopfnekrose ...
Warum habe ich nach ausgiebigem Genuss ständig Schmerzen in der Hüfte und den Beinen?
1. Als die Nacht hereinbrach, spielten Wang Wei u...
Sommer Sexualleben sollten auf drei Punkte achten nicht erzwingen
Auf drei Dinge solltest du beim Sex im Sommer ach...
Der Hauptschaden von Gallenblasenpolypen ist ihre hohe Läsion
Im Allgemeinen wird die Gefährlichkeit von Gallen...
Kann eine Lendenmuskelzerrung von selbst heilen?
Eine Überlastung der Lendenmuskulatur heilt mögli...
Die vier Frauentypen, die für erfolgreiche Männer am schwierigsten zu erobern sind
Ein erfolgreicher Mann sollte nicht nur in seiner...