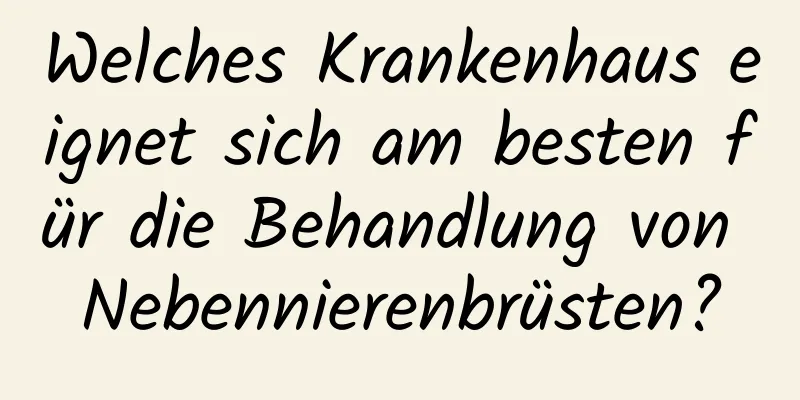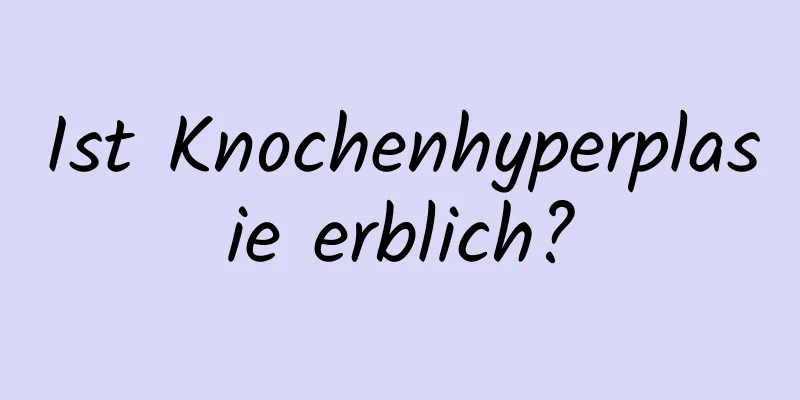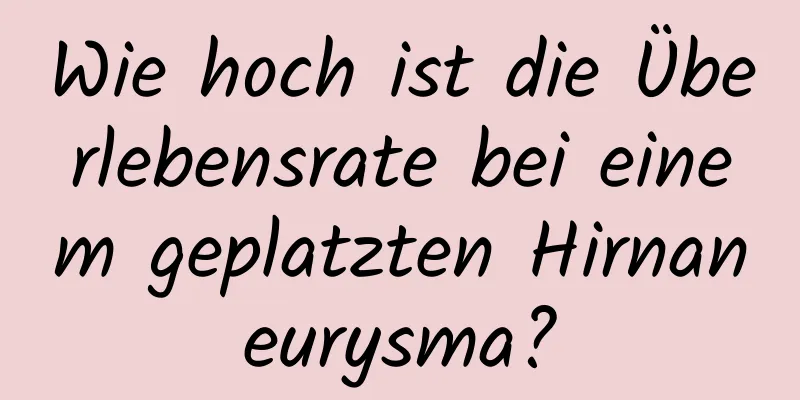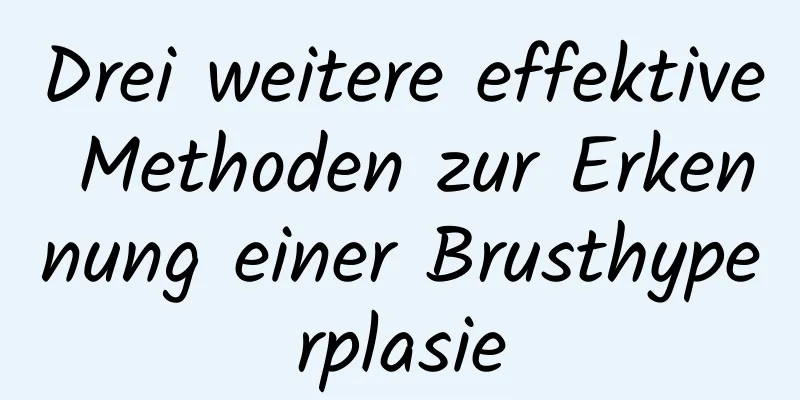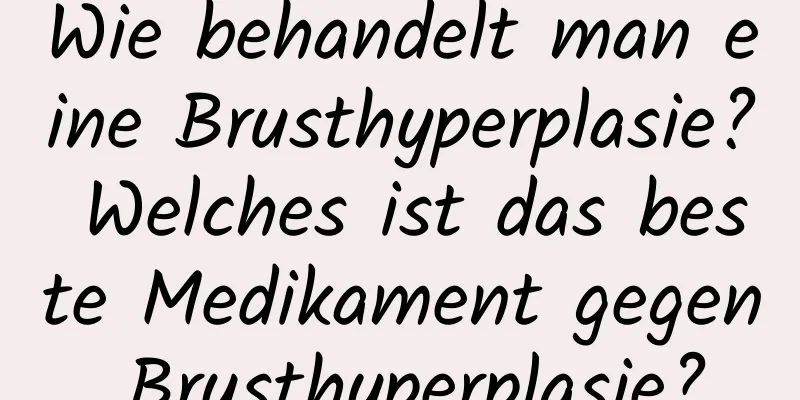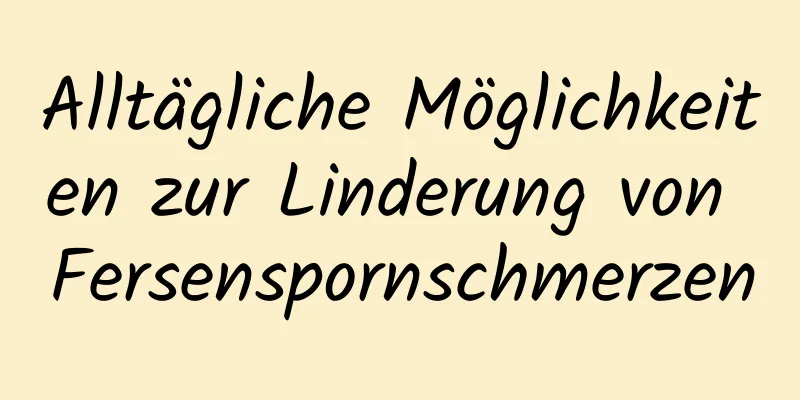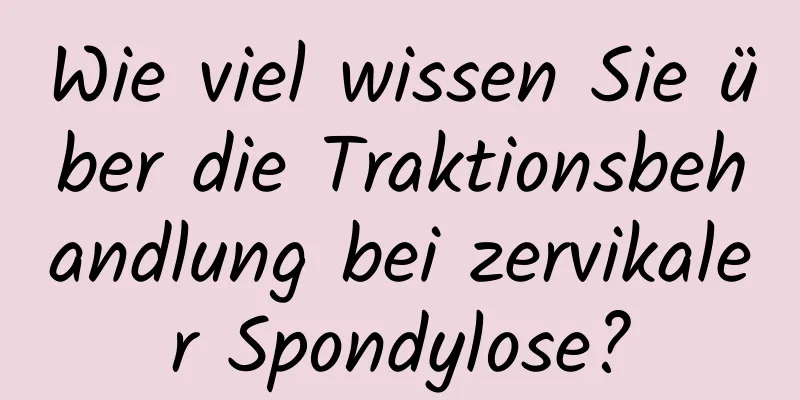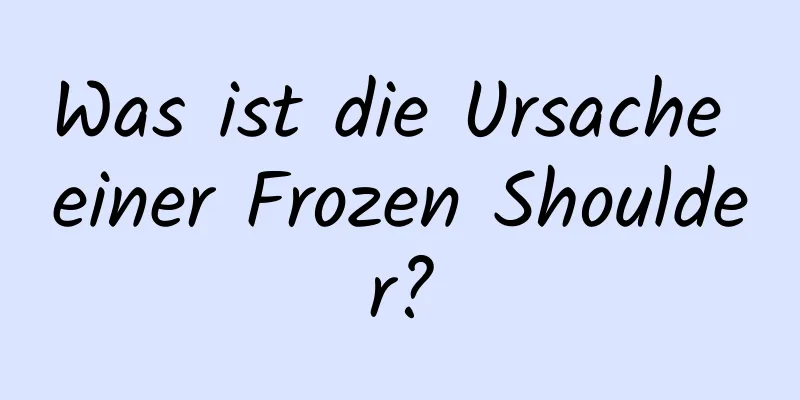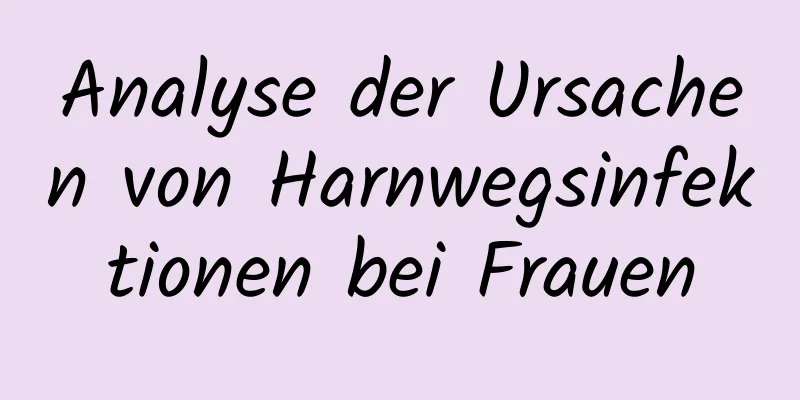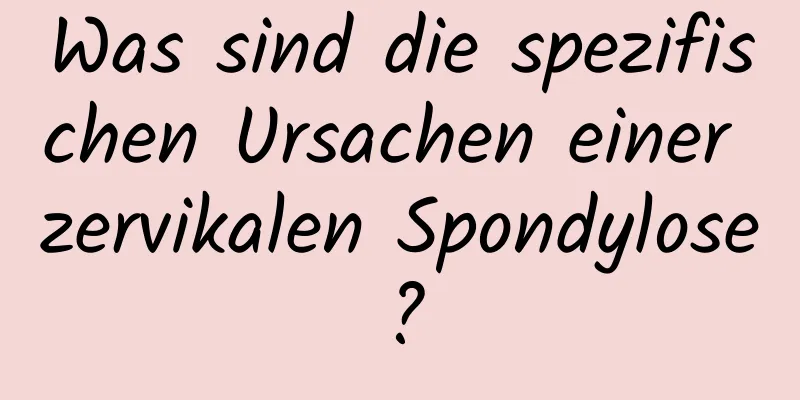Was sind die Symptome einer Pyelonephritis? Was ist der Unterschied zwischen einer Pyelonephritis und einer Harnwegsinfektion?
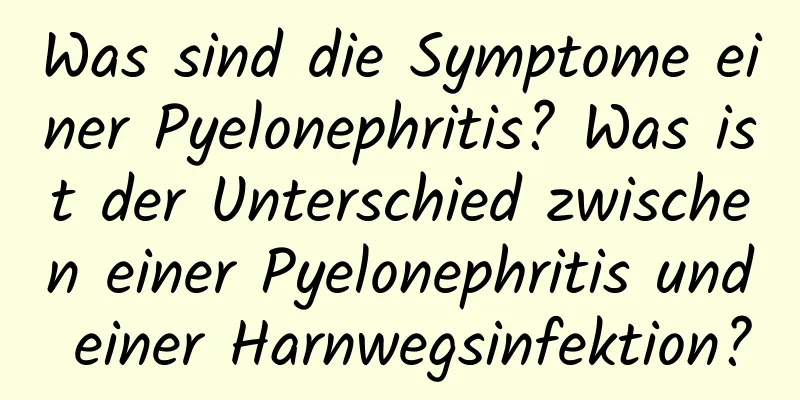
|
Unter einer Pyelonephritis versteht man eine Entzündung des Nierenbeckens, die meist durch eine bakterielle Infektion verursacht wird und meist mit einer Entzündung der unteren Harnwege einhergeht. Eine streng klinische Unterscheidung ist schwierig. Je nach klinischem Verlauf und Erkrankung kann die Pyelonephritis in zwei Stadien unterteilt werden: akut und chronisch. Chronische Pyelonephritis ist eine wichtige Ursache für chronisches Nierenversagen. Frühe Symptome: oft begleitet von Müdigkeit, Appetitlosigkeit, Rückenschmerzen und möglicherweise leichtem oder gar keinem Fieber. Spätsymptome: Aufgrund der Nierenschädigung können Symptome einer Urämie wie Schwindel, Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbrechen auftreten. Darüber hinaus können Polyurie, vermehrte Nykturie, Hypokaliämie, Hyponatriämie oder chronische renale tubuläre Azidose auftreten. Verwandte Symptome: Rückenschmerzen, Druckempfindlichkeit im Nierenbereich, hohes Fieber und Schüttelfrost, Fieber, Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbrechen 1. Anamnese: Die Anamnese einer akuten Pyelonephritis kann als Referenz für die Diagnose verwendet werden, sie kann jedoch nicht als Grundlage dienen. Bei den meisten Patienten mit nicht-obstruktiver chronischer Pyelonephritis liegt möglicherweise keine Vorgeschichte einer Harnwegsinfektion oder einer anderen Nierenerkrankung vor. Die Krankheit beginnt oft schleichend und Symptome einer Azotämie können das erste Symptom des Patienten sein, daher sollte bei der Diagnose darauf geachtet werden. 2. Zu den klinischen Manifestationen zählen intermittierende Reaktionen und Symptome einer Reizung der Harnwege, die im Allgemeinen milder und nicht so offensichtlich sind wie bei einer akuten Pyelonephritis. Sie gehen häufig mit Müdigkeit, Appetitlosigkeit und Schmerzen im unteren Rückenbereich einher und können mit leichtem oder gar keinem Fieber einhergehen. Im Spätstadium können aufgrund der Nierenschädigung Symptome einer Urämie wie Schwindel, Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbrechen auftreten. Darüber hinaus können Polyurie, vermehrte Nykturie, Hypokaliämie, Hyponatriämie oder chronische renale tubuläre Azidose auftreten. Bei manchen Patienten treten schleichende oder atypische Symptome auf. Seien Sie daher bitte vorsichtig. 3. Zusatzprüfung ⑴ Urinanalyse: Im Urin sind im Allgemeinen Spuren oder geringe Mengen an Protein vorhanden. Wenn der Urinproteinwert >3,0/24 Stunden beträgt, handelt es sich möglicherweise nicht um diese Krankheit. Urinsediment kann eine geringe Menge an roten und weißen Blutkörperchen enthalten. Das Vorhandensein von weißen Blutkörperchenzylindern ist für die Diagnose hilfreich, ist jedoch nicht spezifisch für diese Krankheit. ⑵ Urinkultur: Wie bei akuter Pyelonephritis, jedoch ist die Positivrate niedriger und manchmal sind wiederholte Untersuchungen erforderlich, um ein positives Ergebnis zu erhalten. Protoplasmatische Stämme können bei etwa 20 % der Patienten mit negativer Urinbakterienkultur gefunden werden. Dabei handelt es sich um die Fähigkeit pathogener Bakterien, sich an widrige Umgebungen anzupassen und unter der Einwirkung antibakterieller Medikamente, Antikörper usw. zu überleben. Auch wenn die Zellmembran zerstört ist, ist das Protoplasma noch vorhanden und kann sich erneut vermehren, sobald die Umgebung günstig ist. Wenn die Urinkultur und der Test auf in Antikörpern eingekapselte Bakterien im Urin nach der Blasensterilisation positiv ausfallen, hilft dies bei der Diagnose dieser Krankheit und kann sie von einer Blasenentzündung unterscheiden. ⑶ Nierenfunktionstest: Normalerweise liegt eine verminderte Nierentubulusfunktion (verminderte Urinkonzentrationsfunktion, verminderte Phenolrot-Ausscheidungsrate usw.), eine erhöhte Natrium- und Kaliumausscheidung im Urin sowie eine metabolische Azidose vor. Bei oligurischem Urin kann der Kaliumspiegel im Blut ansteigen. Im Spätstadium können glomeruläre Dysfunktion, erhöhte Harnstoffstickstoff- und Kreatininwerte im Blut sowie Urämie auftreten. ⑷Röntgenangiographie: Deformationen des Nierenbeckens und der Nierenkelche, unregelmäßige oder sogar geschrumpfte Schatten sind zu erkennen. Hauptursache: Harnwegsinfektion Pyelonephritis ist eine infektiöse Entzündung der Nierenbecken- und Kelchschleimhaut, der Nierentubuli und des Niereninterstitiums, die durch das direkte Eindringen verschiedener pathogener Mikroorganismen verursacht wird. In den letzten Jahren wurde festgestellt, dass im Nierennarbengewebe einiger Patienten mit Pyelonephritis pathogene Antigene vorhanden sind, was darauf hindeutet, dass eine immunbedingte Schädigung des Nierengewebes auch eine der Entzündungsursachen bei der Pathogenese der Pyelonephritis sein kann. 1. Pathogene Bakterien: Die häufigsten pathogenen Bakterien, die Pyelonephritis verursachen, sind Escherichia coli, gefolgt von Escherichia coli, Proteus, Streptococcus faecalis usw. 2. Übertragungswege: 1. Aufsteigende Infektion: Die aufsteigende Infektion ist der häufigste Infektionsweg. Wenn die Widerstandskraft des Körpers geschwächt und die Harnröhrenschleimhaut leicht geschädigt ist, können Bakterien leicht in die Blase und die Nieren eindringen und Infektionen verursachen. Da die weibliche Harnröhre viel kürzer und breiter ist als die männliche Harnröhre, wird die Harnröhrenöffnung weiblicher Babys häufig durch Kot verunreinigt, wodurch sie leicht krank werden können. Bakterien, die in die Nieren aufsteigen, dringen zunächst in die Nierenbeckenschleimhaut ein und verursachen dort eine Entzündung. Anschließend steigen sie durch die Nierenkelche, Papillen und Nierentubuli auf und dringen in das Nierenparenchym ein. 2. Hämatogene Infektion: Bakterien dringen aus Läsionen im Körper in den Blutkreislauf ein und erreichen die Nieren, wo sie Entzündungen verursachen. Bei einer hämatogenen Infektion gelangen die Bakterien zunächst in die Nierenrinde, bilden dort zahlreiche kleine Abszesse und breiten sich dann entlang der Nierentubuli nach unten bis zur Nierenpapille und zum Nierenbecken aus. 3. Lymphatische Infektion; 4. Direkte Infektion: Wenn in den an die Niere angrenzenden Organen ein Trauma oder eine Infektion auftritt, können Bakterien direkt in die Nierenvenen eindringen und eine Entzündung verursachen. Bei Patienten mit chronischer Pyelonephritis ist es notwendig, die Körperkonstitution zu stärken, die Abwehrkräfte des Körpers zu verbessern und verschiedene auslösende Faktoren wie Diabetes, Nierensteine und Harnwegsobstruktionen zu eliminieren, entzündliche Läsionen wie Prostatitis bei Männern, Entzündungen der paraurethralen Drüsen, Vaginitis und Zervizitis bei Frauen aktiv zu finden und zu entfernen, unnötige Katheterisierungen und Operationen an den Harnwegen zu reduzieren. Wenn die Katheterisierung beibehalten werden muss, sollten Antibiotika vorbeugend eingesetzt werden. Frauen mit einem destruktiven Sexualleben sollten sofort nach dem Geschlechtsverkehr urinieren und eine Dosis SMZ-TMP oral einnehmen. Achten Sie während der Schwangerschaft und Menstruation besonders auf die Sauberkeit der Vulva. Nehmen Sie während der Menopause 1-2 Mal im Monat 1-2 mg Nialestradiol ein, um die lokale niedrige Resistenz zu verbessern. 1. Behandlung der Pyelonephritis durch die westliche Medizin 1. Allgemeine Behandlung Ziel ist es, die Symptome zu lindern, ein Wiederauftreten zu verhindern und die Schädigung des Nierenparenchyms zu verringern. Die Patienten sollten dazu angehalten werden, viel Wasser zu trinken und häufig zu urinieren, um den medullären osmotischen Druck zu senken, die Funktion der körpereigenen Phagozytenzellen zu verbessern und Zellen aus der Blase auszuspülen. Normalerweise sollten die Patienten dazu angehalten werden, mehr Wasser zu trinken und häufig zu urinieren, um den medullären osmotischen Druck zu senken und die Phagozytenfunktion des Körpers zu verbessern. Wenn Sie Symptome einer systemischen Infektion wie Fieber haben, sollten Sie Bettruhe einhalten. Die dreimal tägliche Einnahme von 1 g Natriumbicarbonat kann den Urin alkalisieren, Symptome einer Blasenreizung lindern und die Wirksamkeit von Aminoglykosid-Antibiotika, Penicillin, Erythromycin und Sulfonamiden steigern, kann jedoch die Wirksamkeit von Tetracyclin und Furazolidon verringern. Patienten mit prädisponierenden Faktoren wie Nierensteinen, Harnleiterfehlbildungen usw. sollten behandelt werden. Eine antiinfektiöse Behandlung erfolgt am besten auf der Grundlage einer Urinbakterienkultur und eines Arzneimittelempfindlichkeitstests. 2. Anti-Infektionsbehandlung (1) Akute Pyelonephritis: Die wichtigsten Bakterien, die Harnwegsinfektionen verursachen, sind gramnegative Bakterien, unter denen Escherichia coli am häufigsten vorkommt. Bei einer akuten Pyelonephritis können zunächst 2 Tabletten Trimethoprim-Sulfamethoxazol (SMZ-TMP) 2-mal täglich, 3- bis 4-mal täglich 0,5 g Pipemidsäure oder 3-mal täglich 0,2 g Norfloxacin eingenommen werden. Die Behandlungsdauer beträgt 7 bis 14 Tage. Bei Patienten mit schwerer Infektion und Sepsis wird eine intravenöse Verabreichung empfohlen. Die Auswahl empfindlicher Medikamente erfolgt auf Grundlage der Ergebnisse der Urinkultur. Beispielsweise liegen die Empfindlichkeitsraten von Cefoperazon- und Amikacin-Toxin gegenüber Staphylococcus, Klebsiella, Proteus, Pseudomonas aeruginosa und Escherichia coli alle über 90 %. Ersteres beträgt 1–2 g, einmal alle 8–12 Stunden, und Letzteres beträgt 0,4 g, einmal alle 8–12 Stunden. Die Empfindlichkeitsrate von Fluorchinolonen gegenüber Proteus, Citrobacter und Klebsiella liegt bei über 80 %. Piperacillin, Ampicillin und Nitrofurantoin sind zu 100 % empfindlich gegenüber Enterokokken der Gruppe D. Anwendung: die ersten beiden, 1-2 Mal, einmal alle 6 Stunden; Letzteres 0,1 g, 3-mal täglich. Nehmen Sie bei Pilzinfektionen dreimal täglich 0,2 g Ketoconazol ein. Oder Fluconazol 50 mg, zweimal täglich. Eine akute Pyelonephritis bei Neugeborenen, Säuglingen und Kindern unter 5 Jahren geht meist mit Fehlbildungen und Funktionsstörungen der Harnwege einher und ist daher schwer zu beseitigen. Einige Funktionsstörungen, wie beispielsweise der vesikoureterale Reflux, können jedoch mit zunehmendem Alter verschwinden. Bei einmaliger oder mehrmaliger Harninkontinenz kann es zu narbigen Herden im Nierengewebe kommen, die sogar die Nierenentwicklung beeinträchtigen können. In den letzten Jahren wurde empfohlen, vor der Einnahme von Medikamenten möglichst immer eine Mittelstrahlurinkultur durchzuführen. Um das Problem rechtzeitig zu erkennen und zu behandeln, sollte die Urinkultur 2, 4 und 6 Wochen nach Absetzen des Medikaments wiederholt werden. (2) Chronische Pyelonephritis: Patienten mit akuten Episoden sollten wie Patienten mit akuter Pyelonephritis behandelt werden. Bei Patienten mit wiederkehrenden Episoden sollte eine Urinbakterienkultur und eine Identifizierung des Bakterientyps durchgeführt werden, um festzustellen, ob es sich bei dem erneuten Auftreten um einen Rückfall oder eine Neuinfektion handelt. Rückfall: Bezieht sich auf einen Stamm, der nach der Behandlung negativ wird, aber innerhalb von 6 Wochen nach Absetzen des Medikaments wieder auftritt und bei dem es sich um genau denselben Erreger wie bei der vorherigen Infektion handelt. Zu den häufigsten Ursachen für einen Rückfall zählen: ① Anatomische oder funktionelle Anomalien im Harntrakt führen zu einem schlechten Harnfluss. Dies kann durch eine intravenöse Pyelographie oder eine retrograde Pyelographie bestätigt werden. Liegen offensichtliche anatomische Anomalien vor, ist eine Operation zur Korrektur erforderlich. Wenn die obstruktiven Faktoren schwer zu beseitigen sind, sollten geeignete Antibiotika auf der Grundlage der Arzneimittelempfindlichkeit ausgewählt und 6 Wochen lang behandelt werden. 2 Eine falsche Auswahl der Antibiotika oder eine unzureichende Dosierung und Behandlungsdauer führen häufig zu einem Rückfall. Die Medikamente können je nach Arzneimittelempfindlichkeit ausgewählt werden und die Behandlung sollte 4 Wochen dauern. 3 Aufgrund der Narbenbildung an der Läsionsstelle, der schlechten Durchblutung und der unzureichenden Antibiotikakonzentration in der Läsion kann zur Behandlung eine höhere Dosis bakterizider Antibiotika wie Cefixim, Ampicillin, Hydroxybenzylpenicillin und Beta-Clostridium über einen Zeitraum von 6 Wochen versucht werden. Wenn innerhalb eines Jahres dreimal oder öfter eine Pyelonephritis auftritt, spricht man auch von rezidivierender Harninkontinenz und eine langfristige Behandlung mit niedriger Dosierung kann in Erwägung gezogen werden. Im Allgemeinen werden wenig toxische antibakterielle Medikamente wie Trimethoprim-Sulfamethoxazol oder Furantamin ausgewählt. Eine Tablette pro Nacht über ein Jahr oder länger wird eingenommen, und bei etwa 605 Patienten wird die Bakteriurie negativ. Bei Männern mit wiederkehrender Prostatitis sollte gleichzeitig die chronische Prostatitis mit fettlöslichen antibakteriellen Medikamenten wie Sulfamethoxazol behandelt werden. 0,5 g Cyclofloxacin, zweimal täglich; 0,45–0,6 g Rifampicin, auf einmal eingenommen, die Behandlungsdauer sollte bis zu 3 Monate betragen. Bei Bedarf operative Entfernung der Läsion (Hyperplasie, Tumor) der Prostata. Wenn die Urinbakterien nach zwei Zyklen einer angemessenen antibakteriellen Behandlung weiterhin positiv sind, kann eine langfristige Behandlung mit niedriger Dosierung in Erwägung gezogen werden. Im Allgemeinen wird Cotrimoxazol oder Furadin einmal pro Nacht angewendet und kann ein Jahr oder länger eingenommen werden. Bei etwa 60 % der Patienten wird das Ergebnis negativ. Reinfektion: bezeichnet eine Infektion durch einen anderen Erreger als den vorherigen, der in die Harnwege eindringt, nachdem die Bakteriurie negativ geworden ist. Normalerweise tritt es 6 Wochen nach dem negativen Befund der Bakteriurie erneut auf. Bei 85 % der wiederkehrenden Harnwegsinfekte bei Frauen handelt es sich um Reinfektionen und können wie beim ersten Anfall behandelt werden. Dabei wird den Patientinnen geraten, auf die Vorbeugung von Harnwegsinfekten zu achten. Gleichzeitig sollte eine umfassende Untersuchung durchgeführt werden, um mögliche Risikofaktoren festzustellen und diese zu beseitigen. 2. TCM-Behandlung von Pyelonephritis Pyelonephritis tritt häufiger bei Frauen auf und fällt in der traditionellen chinesischen Medizin unter die Kategorie Gonorrhoe. Man unterscheidet zwischen akuten und chronischen Formen. Bei einer akuten Pyelonephritis treten häufig Symptome wie Fieber, Harndrang, häufiges Wasserlassen, Schmerzen und heißer Urin auf. Es handelt sich um ein Feucht-Hitze-Syndrom und das Rezept lautet Renzheng San mit Modifikationen. Dieses Rezept umfasst Akebia, Dianthus superbus, Polygonum multiflorum, Phellodendron chinense, Plantago-Samen, Glehnia littoralis, Imperata-Rhizom und Cirsium japonicum. In Bezug auf die Ernährung sollten Sie alle salzigen Gewürze und proteinreichen Lebensmittel vermeiden und mehr Gemüse und Obst essen, das Vitamin C enthält. Eine chronische Pyelonephritis ist häufig durch Bakteriurie und Veränderungen im Urinablauf gekennzeichnet, begleitet von Symptomen wie Schmerzen im unteren Rückenbereich, Müdigkeit, Kurzatmigkeit, Schwindel, Ödemen und Gewichtsverlust. Die traditionelle chinesische Medizin geht davon aus, dass es sich hierbei um ein Syndrom handelt, das auf eine Insuffizienz sowohl der Milz als auch der Nieren zurückzuführen ist. Die Zusammensetzung dieses Rezepts lautet: 10 Gramm Codonopsis pilosula, 10 Gramm Atractylodes macrocephala, 10 Gramm getrocknete Mandarinenschale, 10 Gramm Rehmannia glutinosa, 10 Gramm Alisma orientalis, 20 Gramm Astragalus membranaceus, 20 Gramm Poria cocos, 15 Gramm Dioscorea batatas, 15 Gramm Eucommia ulmoides, 6 Gramm Amomum villosum, 3 Gramm Costus-Wurzel und 5 Gramm rohe Lakritze. Wenn der Patient Angst vor Kälte hat und kalte Gliedmaßen hat, fügen Sie 6 Gramm gerösteten Eisenhut und 10 Gramm Zimt hinzu; Wenn der Patient an Hämaturie leidet, fügen Sie 15 Gramm Houttuynia cordata und 30 Gramm Cirsium japonicum hinzu. In Bezug auf die Ernährung empfiehlt sich eine leichte und bekömmliche Kost mit wenig oder gar keiner Salzzufuhr. In den letzten Jahren geht man davon aus, dass eine angemessene Ergänzung essentieller Aminosäuren die therapeutische Wirkung bei Patienten mit chronischer Niereninsuffizienz verbessern kann. Wassermelone: Sie wirkt hitzelösend, harntreibend und entgiftend. Mäßig Wintermelone: lindert Hitze, fördert die Diurese und wirkt abschwellend, eignet sich zur Suppenzubereitung Chinesische Yamswurzel: Die chinesische Yamswurzel ist süß, mild und leicht kühlend und kann die Milz stärken sowie Feuchtigkeit und Hitze beseitigen. Es kann nach dem Dämpfen oder Kochen gegessen werden. Lamm: Lamm ist von Natur aus warmherzig und kann leicht Trockenheit und Hitze verursachen. Chili-Pfeffer: Scharfes Essen kann den Zustand verschlimmern. Auch Senf und Pfeffer sind nicht zum Verzehr geeignet. Kleine Paprika: Enthält viel Cholesterin, was der Behandlung von Krankheiten nicht förderlich ist. Auch andere fettige Speisen sollten vermieden werden. |
<<: Kennen Sie die acht Symptome einer reaktiven Arthritis? Beste Behandlung für reaktive Arthritis
Artikel empfehlen
Wichtige Punkte zur Gesundheitsvorsorge für das Sexualleben im Sommer
Im theoretischen System der Medizin gibt es das K...
Ernährungsüberlegungen für Patientinnen mit Brusthyperplasie
Die Ernährung spielt bei der Behandlung und Gesun...
Symptome von zwei Arten von Ischias
Die Menschen schenken dem Thema Ischias immer meh...
Kann eine lobuläre Hyperplasie von selbst vollständig heilen?
Wenn eine lobuläre Hyperplasie auftritt, schenken...
Die Ursache von Hämorrhoiden kann mit langem Sitzen oder Stehen zusammenhängen
Die Ursache für Hämorrhoiden kann langes Sitzen o...
8 Dinge, die eine kluge Braut nach der Rückkehr von den Flitterwochen tun muss
Denken Sie nicht, dass die Hochzeit nach der Rück...
Wie man chronische Osteomyelitis behandelt
Im Leben ist den meisten Menschen die Behandlung ...
Das geeignete Alter für die chirurgische Behandlung einer Trichterbrust
Trichterbrust ist eine angeborene und häufig fami...
Zwei weitere offensichtliche Symptome eines Bandscheibenvorfalls in der Lendenwirbelsäule
Im wirklichen Leben gibt es zwei relativ offensic...
Warum kommt es zu einer Hüftkopfnekrose?
Die Femurkopfnekrose ist eine der häufigsten und ...
Experten erklären Patienten, wie sie eine Hüftkopfnekrose behandeln können
Die Femurkopfnekrose ist eine der häufigsten orth...
Was sind die Unterschiede zwischen Blasenentzündung und Harnröhrenentzündung?
Der Hauptunterschied zwischen den Symptomen einer...
Zur Behandlung von Knochenspornen müssen die richtigen Maßnahmen ergriffen werden
Knochensporne sind eine Erkrankung, von der man s...
Beeinträchtigt eine glanduläre Zystitis die Fruchtbarkeit?
Ob eine Drüsenzystitis die Fruchtbarkeit beeinträ...
Was sind die Ursachen für Rektumpolypen?
Kennen Sie Rektumpolypen? Rektumpolypen sind eine...