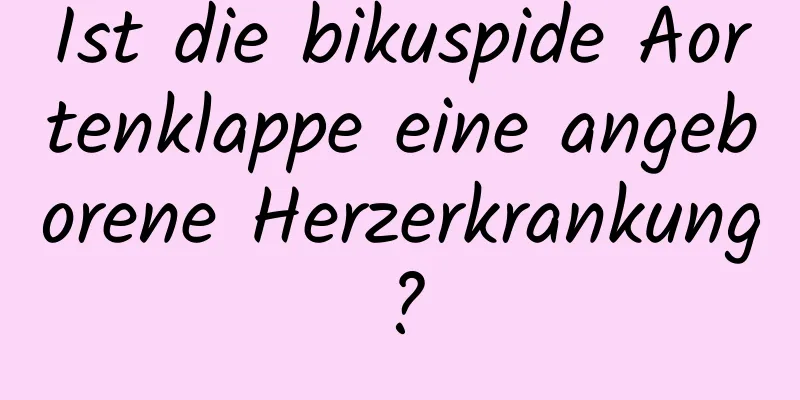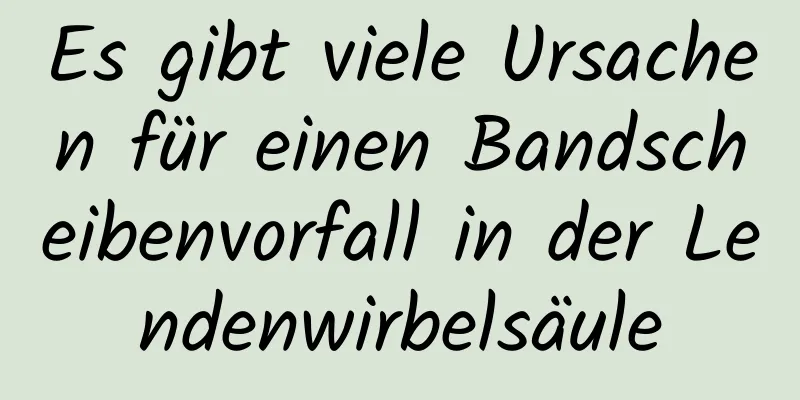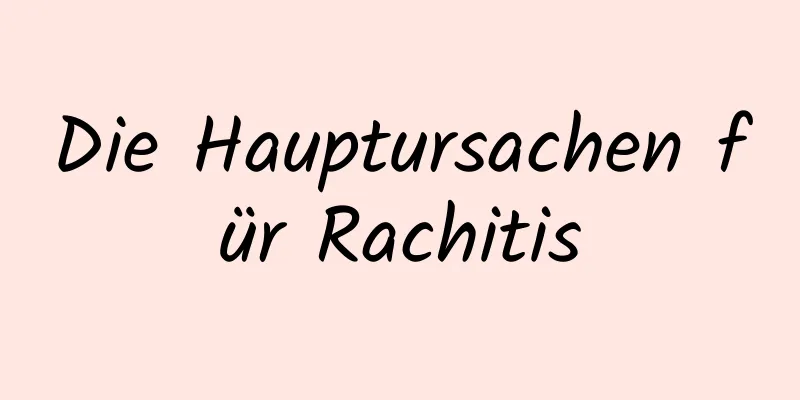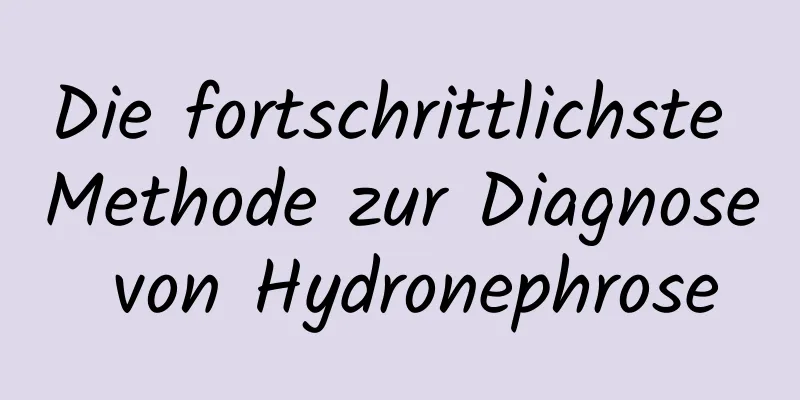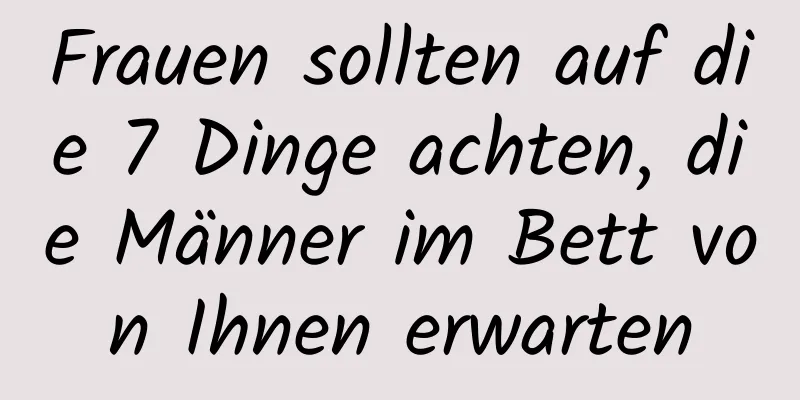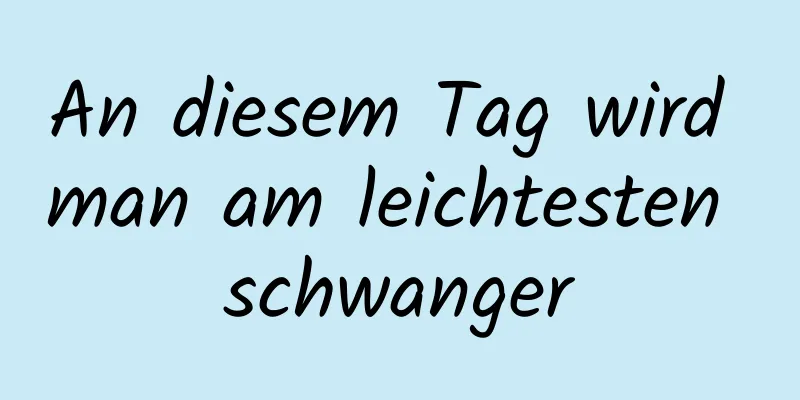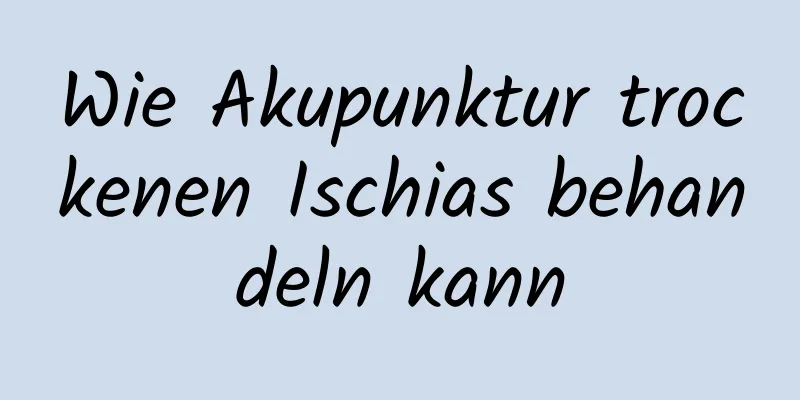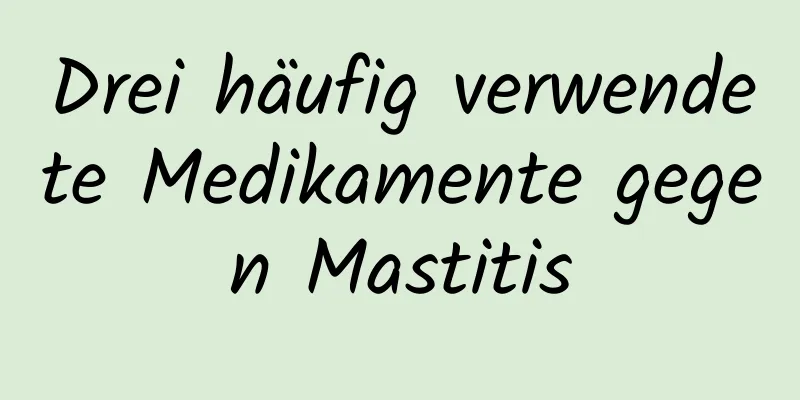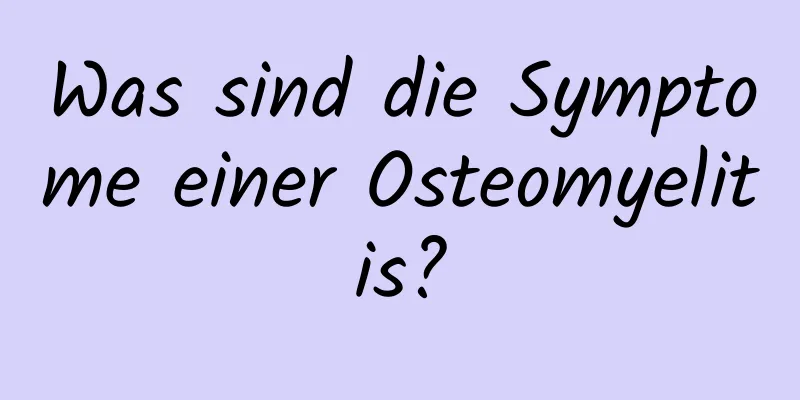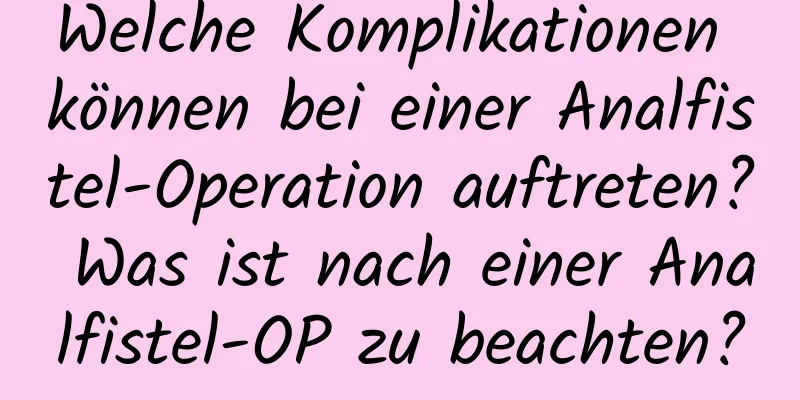Kann Dranginkontinenz geheilt werden? Diese beiden Methoden sind sehr nützlich
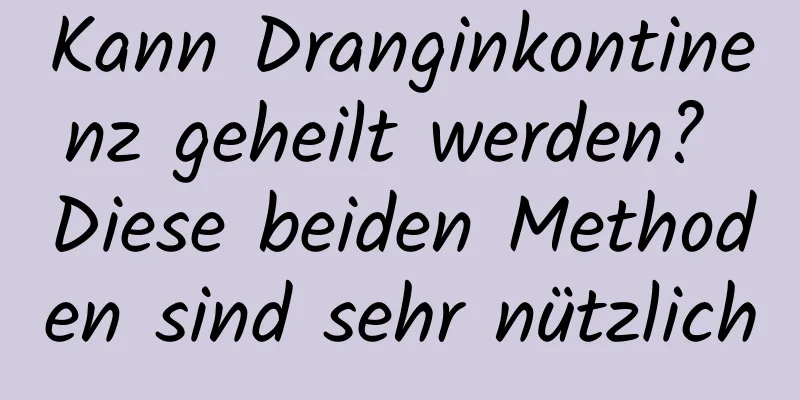
|
Bei der Dranginkontinenz handelt es sich um einen dringenden Harndrang, der mit unwillkürlichem Urinverlust einhergeht. Man unterscheidet zwei Kategorien: Bei der einen zieht sich der Detrusormuskel beim Füllen der Blase spontan oder induziert (z. B. durch Husten) zusammen, wodurch der Druck in der Blase den Harnröhrendruck übersteigt und es zu Urinverlust kommt. Dies wird als Belastungsinkontinenz bezeichnet. Derzeit bestehen die Behandlungen für Dranginkontinenz hauptsächlich aus Verhaltenstherapie und medikamentöser Therapie. Harninkontinenz ist ein weit verbreitetes Problem, das Frauen häufiger betrifft als Männer. Belastungsinkontinenz und Dranginkontinenz sind die häufigsten Formen der Harninkontinenz. Vielen Menschen ist dieses Problem peinlich, aber wichtig zu wissen ist, dass Harninkontinenz in der Regel behandelbar ist. Sie sollten sich daher an Ihren Hausarzt wenden. Was ist Harninkontinenz? Wenn Sie an Harninkontinenz leiden, bedeutet dies, dass Sie Urin ausscheiden, obwohl Sie es nicht möchten (unwillkürlicher Urinverlust). Es kann sich um alles Mögliche handeln, von einem gelegentlichen kleinen Tröpfeln bis hin zu einer großen Urinmenge. Harninkontinenz kann schmerzhaft sein und ein Hygieneproblem darstellen. Urin und Blase verstehen Die Nieren produzieren kontinuierlich Urin. Durch die Harnleiter, die von den Nieren zur Blase führen, fließt ständig eine kleine Menge Urin in die Blase. Die Menge des von Ihnen produzierten Urins hängt davon ab, wie viel Sie trinken, essen und schwitzen. Die Blase besteht aus Muskeln und speichert den Urin. Wenn es sich mit Urin füllt, dehnt es sich wie ein Ballon aus. Der Ausgang für den Urin (die Harnröhre) bleibt normalerweise geschlossen. Unterstützt wird dies durch die Muskeln unterhalb der Blase, die die Harnröhre umgeben und stützen (Beckenbodenmuskulatur). Dass die Blase voll ist, erkennen Sie daran, dass sich eine bestimmte Menge Urin darin befindet. Wenn Sie zum Wasserlassen auf die Toilette gehen, ziehen sich die Blasenmuskeln zusammen (kontrahieren) und die Harnröhren- und Beckenbodenmuskulatur entspannt sich, wodurch der Urin abfließen kann. Zwischen Gehirn, Blase und Beckenbodenmuskulatur werden komplexe neuronale Botschaften übertragen. Diese zeigen Ihnen an, wie voll Ihre Blase ist, und weisen die richtigen Muskeln an, sich zum richtigen Zeitpunkt zusammenzuziehen oder zu entspannen. Wie häufig ist Harninkontinenz? Harninkontinenz kommt häufig vor, insbesondere bei Frauen. Es kann in jedem Alter auftreten, die Wahrscheinlichkeit einer Entwicklung mit zunehmendem Alter steigt jedoch. Schätzungsweise 3 Millionen Menschen in Großbritannien leiden regelmäßig an Inkontinenz. Insgesamt sind das etwa 4 von 100 Erwachsenen. Allerdings leidet bis zu jede fünfte Frau über 40 an einer Harninkontinenz in gewissem Ausmaß. Die tatsächliche Zahl der Betroffenen dürfte deutlich höher sein. Viele Menschen erzählen ihrem Arzt aus Scham nichts von ihrer Inkontinenz. Manche Menschen glauben fälschlicherweise, dass Harninkontinenz ein normaler Teil des Alterns sei oder dass sie nicht behandelt werden könne. Dies ist bedauerlich, da viele Fälle erfolgreich behandelt oder deutlich gelindert werden können. 1. Aktionstherapie: Versuchen Sie, innerhalb einer vorgegebenen Zeit zu urinieren und führen Sie dabei kontinuierlich abwechselnd ein Anspannungs- und Entspannungstraining des Musculus levator ani durch. Verschwindet der Harndrang, kann sich die Harnausscheidung sogar wieder normalisieren. 2. Arzneimitteltherapie: umfasst vier Kategorien: Anticholinergika, adrenerge Präparate, direkte Glattmuskelrelaxantien und Acetylcholinergrezeptorblocker. 1) Anticholinerge Präparate: Probencin, 15–30 mg/Mal, 2–4 Mal täglich, gegen Detrusorspasmus. 2) Adrenerge Präparate: Imipraminhydrochlorid ist ein trizyklischer Inhibitor und eine Dibenzozepinverbindung. Dieses Präparat blockiert die Rückresorption von Noradrenalin an den postganglionären sympathischen Nervenendigungen, hat also α- und β-adrenerge Effekte, erhöht den Harnröhrendruck durch α-adrenerge Stimulation und erhöht die Blasenkapazität durch Stimulation der β-Rezeptoren der Blase. Dosierung: Kinder ab 6 Jahren nehmen täglich 25 mg vor dem Schlafengehen oral ein, die Dosis kann auf 75 mg erhöht werden; Erwachsene nehmen täglich 100–200 mg in aufgeteilten Dosen oral ein. 3) Direkte Glattmuskelrelaxantien: Uroquin: Es ist ein direktes Glattmuskelrelaxans, hat keine cholinergen oder adrenergen Rezeptoreffekte und ist kein starkes Medikament. Es eignet sich für Detrusorspasmen, die durch neurogene oder nicht-neurogenen Faktoren verursacht werden. Dosierung: 100–200 mg jedes Mal, 3–4 Mal täglich. 4) Acetylcholin-Rezeptorblocker: Hydroxybuttersäure (Uredolin): Sie hat eine entspannende und anästhetische Wirkung auf den Detrusormuskel der Blase, kann Blasenkrämpfe lindern und hat eine gute schmerzstillende Wirkung. Das Medikament hat eine lange Wirkdauer, kann die Blasenkapazität erhöhen, den ersten Harndrang verzögern und die nicht hemmende Kontraktion der Blase wirksam blockieren und so Symptome wie Harndrang, häufiges Wasserlassen, Schmerzen beim Wasserlassen und Inkontinenz lindern. Es eignet sich für Patienten mit Verletzungen oberhalb des Kreuzbandes und Detrusorhyperreflexie. Die Dosierung beträgt 5 mg, 3 bis 4 Mal täglich. Bei einem Drittel der Patienten können Nebenwirkungen wie Mundtrockenheit, vorübergehend verschwommenes Sehen und Schwierigkeiten beim Wasserlassen auftreten. Bei der Einnahme von Medikamenten sollten die Stärke, die Wirkdauer und die Nebenwirkungen des Arzneimittels berücksichtigt werden. 5) Bei Harninkontinenz aufgrund neurologischer Erkrankungen sollten Aktivatoren des Gehirnstoffwechsels und Neurotransmitter-Verbesserer in Kombination eingesetzt werden. Dranginkontinenz, die durch irritative Läsionen der Blase und Harnröhre aufgrund von Entzündungen, Steinen, invasiven Tumoren, Prostatahyperplasie und Blasenhalssklerose verursacht wird, sollte je nach Ursache behandelt werden. Obstruktive Läsionen können mit einer Kombination aus α-Blockern und Anticholinergika behandelt werden. Bei Neuropathie ist die Behandlung komplizierter und kann mit Anticholinergika, Indomethacin und α-Blockern in Kombination mit Harnwegserkrankungen, Blasenschmerzen und Prostataschmerzen behandelt werden. 3. Elektrodenstimulation: Bei Patienten, bei denen eine Aktionstherapie und eine medikamentöse Behandlung nicht anschlagen, kann eine transkutane Elektrodenstimulation durchgeführt werden. Die Oberflächenelektrode wird auf den Verlauf des Nervus pudendus gelegt, die andere Elektrode wird in den Anus eingeführt. Die Stimulation erfolgt nach der Toleranzgrenze. Jede Stimulation dauert 15 bis 20 Minuten, 1 bis 2 Mal pro Woche und 10 Mal als Behandlungszyklus. Die Stimulation kann viele Male wiederholt werden. 4. Nervenblockade: Bei Patienten, bei denen eine nicht-chirurgische Behandlung nicht anschlägt und die unter Blasenschmerzen, starkem Harnfluss und Dranginkontinenz leiden, kann eine Blockade der Kreuzbeinwirbel (Periduralanästhesie) durchgeführt werden. Es können 5–10 ml Lokalanästhetikum und 20–50 mg Hydrocortison verwendet werden. Die Wirkung eines einzelnen Blocks kann mehrere Stunden anhalten. Wiederholte Behandlungen können den Zustand verbessern. Einige Wissenschaftler haben Phenolblockaden im Trigonum cerebrospinalis der Blase eingesetzt. Bei der Methode wird Phenol unter Endoskopie portionsweise in die submuköse und muskuläre Schicht des Blasendreiecks injiziert. Bei der Methode von Ewing et al. ist diese Konzentration weniger korrosiv für das Gewebe und wird in die peripheren Gewebe des Beckens und des Plexus injiziert. 5. Blasenvergrößerung: Eine Blasenvergrößerung kann bei Harninkontinenz durchgeführt werden, die durch eine Blase mit geringem Fassungsvermögen und geringer Compliance verursacht wird. Das Grundprinzip besteht darin, die Funktionsfähigkeit der Blase zu steigern. Der Nachteil besteht darin, dass aufgrund der vorhandenen Darmperistaltik dennoch ein hoher Druck entstehen kann, der zu Harndrang und Inkontinenz führt. Die Darmschlingen können außerdem das Blasendivertikel komprimieren, was die Entleerung beeinträchtigt und eine Sekundärinfektion oder Steinbildung verursachen kann. Darüber hinaus können auch eine Blasenhalssuspension und eine einseitige Pudendusnervblockade durchgeführt werden. Der Schlüssel liegt darin, das Gleichgewicht zwischen Blasen- und Harnröhrenwiderstand aufrechtzuerhalten. Die letzte Behandlungsmethode ist die intermittierende Katheterisierung. |
<<: Wie kann ich eine Proktitis vollständig heilen? Proktitis, essen Sie weniger davon
>>: Wie lange dauert die Heilung eines zerebralen Vasospasmus?
Artikel empfehlen
Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es für eine Sakroiliitis?
Viele Menschen leiden an vielen Krankheiten, weil...
Spezifische Ursachen verschiedener Knochenhyperplasie-Erkrankungen im menschlichen Körper
Wenn die Ursachen der Knochenhyperplasie schwerwi...
Vier häufige Missverständnisse über zervikale Spondylose
Zervikale Spondylose, auch als zervikales Spondyl...
Wie man Medikamente gegen frühe Mastitis einsetzt
Wenn viele Menschen krank werden, glauben sie, da...
Frühzeitige Mobilisierung kann Ankylose verhindern
Herr Li erlitt aufgrund eines Traumas einen Bruch...
Kann ich weißen Rettich essen, wenn ich Arthritis in Füßen und Knien habe?
Kann man weißen Rettich essen, wenn man Arthritis...
Was kann ich gegen Unfruchtbarkeit tun?
Heiraten und Kinderkriegen ist ein Lebensgesetz. ...
So regulieren Sie die Ernährung bei Venenthrombose der unteren Extremitäten
Wie muss die Ernährung von Patienten mit Venenthr...
Wie man degenerative Kniearthritis behandelt
In den letzten Jahren hat Arthritis unser Leben s...
Was ist die Flüssigkeit, die aus Hämorrhoiden austritt?
Was ist die Flüssigkeit, die aus Hämorrhoiden aus...
Analysieren Sie die Symptome einer Frozen Shoulder mit Experten
Was sind die häufigsten Symptome einer Frozen Sho...
Was soll ich tun, wenn ich beim Stuhlgang häufig blute?
Häufige Blutungen beim Stuhlgang und Hämorrhoiden...
Ist eine Blasenentzündung ansteckend?
Eine Blasenentzündung ist eine häufige Harnwegsin...
Was tun bei Arthritis?
Was tun bei Arthritis? Arthritis ist in der heuti...
Wie lange dauert die Genesung nach einer minimalinvasiven Operation an der Lendenwirbelsäule?
Derzeit gibt es viele minimalinvasive Operationen...