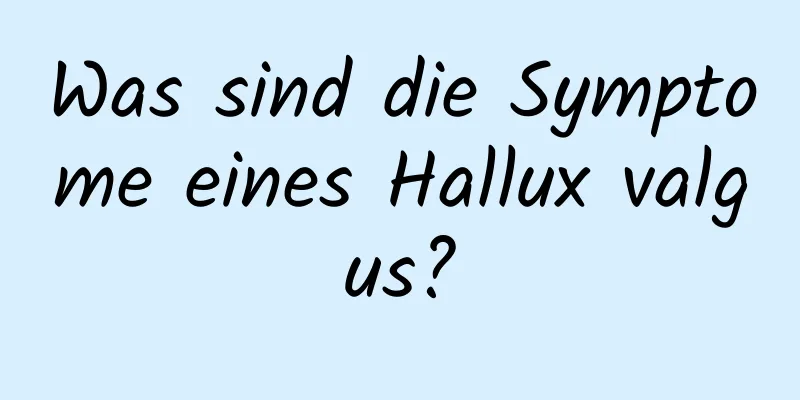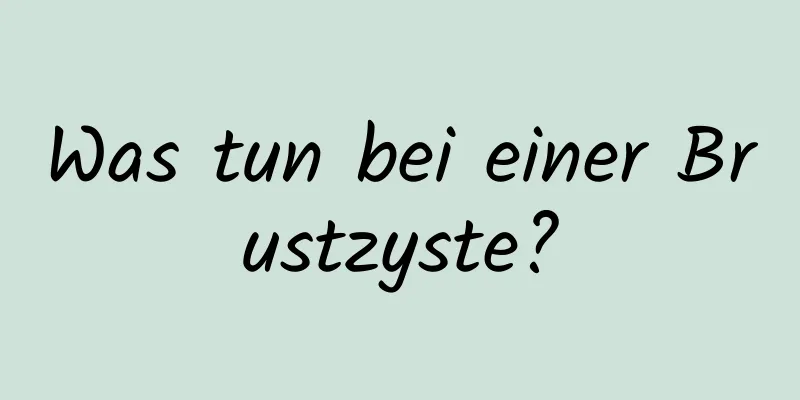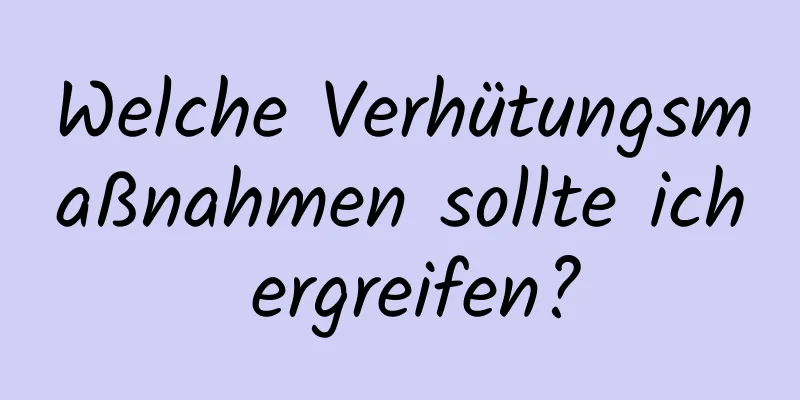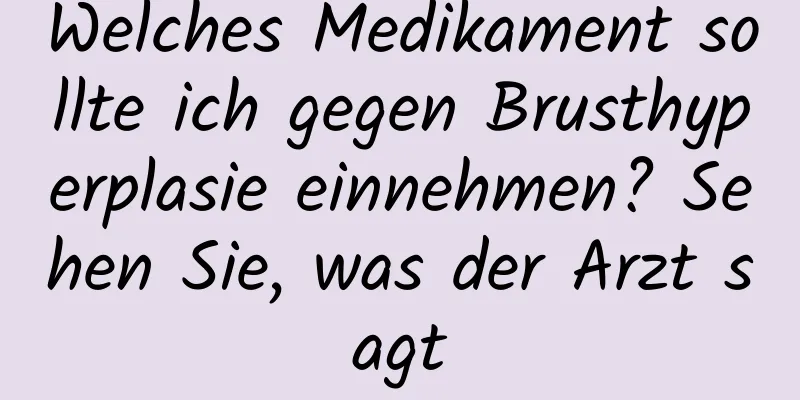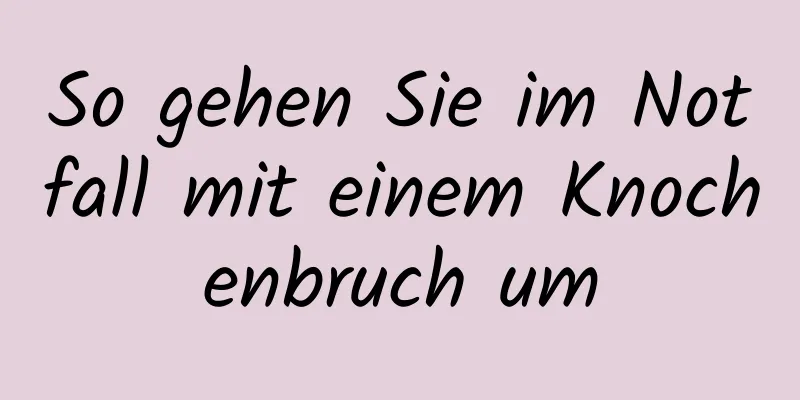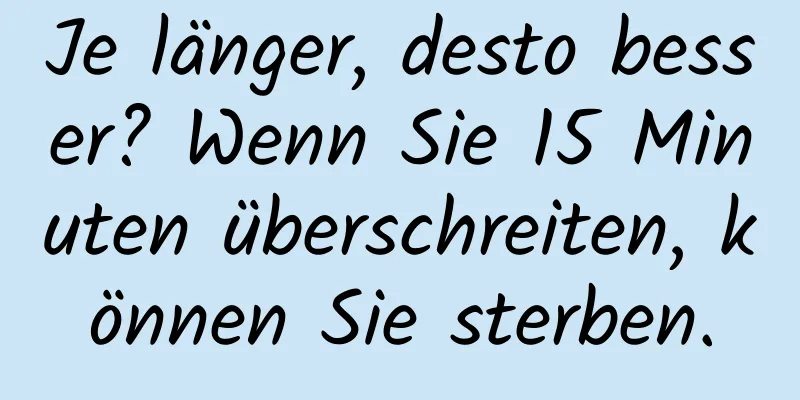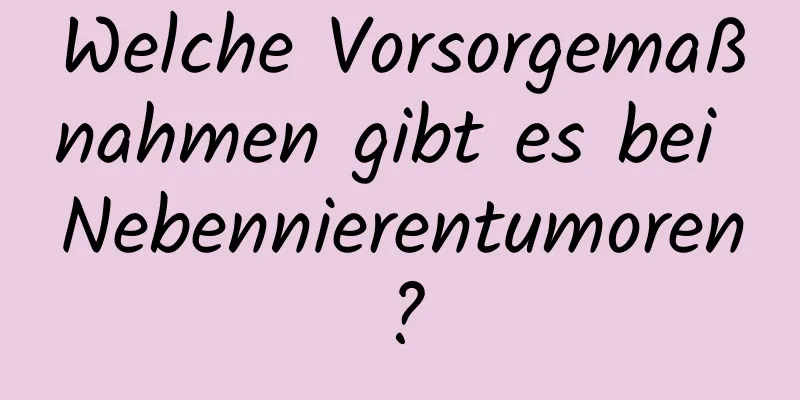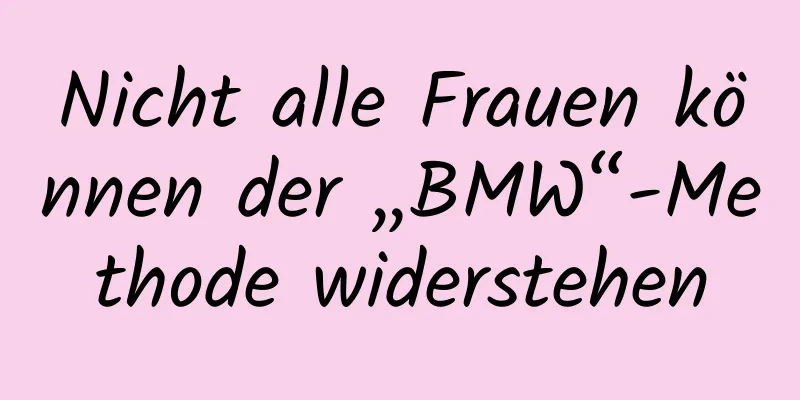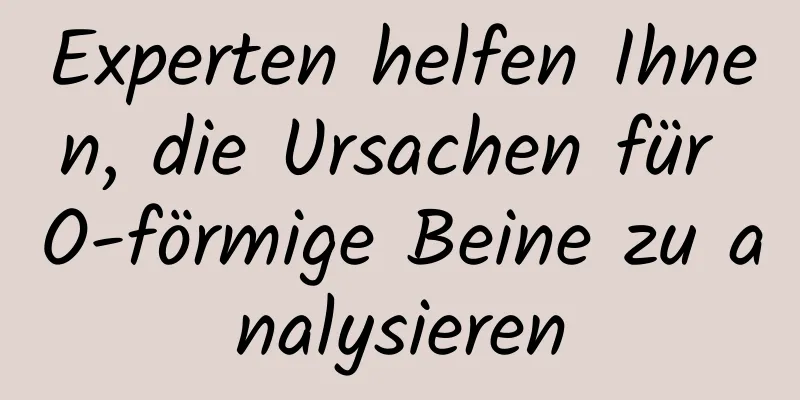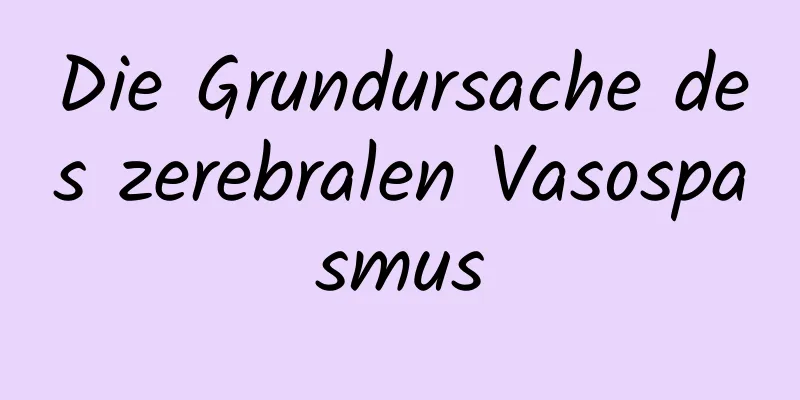Welche Folgen hat eine Rippenfellentzündung?
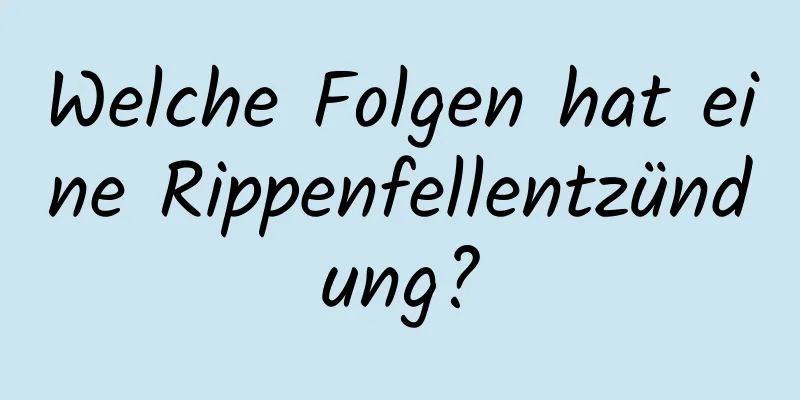
|
Bei einer Pleuritis handelt es sich um eine Entzündung des Brustfells, die durch pathogene Faktoren (meist Viren oder Bakterien) hervorgerufen wird und das Brustfell reizt. Man spricht auch von einer Rippenfellentzündung. Es kann zu einer Flüssigkeitsansammlung im Brustraum kommen (exsudative Pleuritis) oder es kann zu keiner Flüssigkeitsansammlung kommen (trockene Pleuritis). Nachdem die Entzündung unter Kontrolle ist, kann sich die Pleura wieder normalisieren oder die beiden Pleuraschichten können aneinander haften. Welche Folgen hat die Heilung einer Rippenfellentzündung? Der unten stehende Herausgeber wird Ihnen einige Folgen einer Rippenfellentzündung mitteilen. Kommen Sie vorbei und schauen Sie gemeinsam mit der Redaktion vorbei. Folgen einer Pleuritis Bei der tuberkulösen Pleuritis handelt es sich um eine Entzündung, die auftritt, wenn das Brustfell vom Bakterium Mycobacterium tuberculosis befallen wird. Die häufig verwendete Konditionierungsmethode nach dem Ausbruch einer tuberkulösen Pleuritis ist die Kombination von Dekokten und westlichen Medikamenten gegen Tuberkulose. Zur Behandlung der tuberkulösen Pleuritis: - Bruststärkende und entzündungshemmende Suppe - Nehmen Sie täglich 1 Portion, geben Sie diese in einen Tontopf, tränken Sie diese mit 1200 ml Wasser und kochen Sie sie auf, filtern Sie sie nach dem Aufkochen ab und nehmen Sie sie in aufgeteilten Dosen ein. -Hejie Qingre-Abkochung – Nehmen Sie täglich 30 g Rohrkolbengras, 30 g Trichosanthes kirilowii, 15 g rote und weiße Pfingstrosenwurzel, 15 g Hasenohren, 10 g Maulbeerrinde, 10 g Helmkraut, 10 g Pinellia, 10 g Fructus aurantii, 10 g Platycodon grandiflorum und 6 g Süßholz, geben Sie sie zusammen in einen Topf, kochen Sie sie mit Wasser zum Kochen, entfernen Sie den Rückstand und trinken Sie den Saft. Zu den westlichen Tuberkulosemedikamenten, die zur Behandlung der tuberkulösen Pleuritis eingesetzt werden, gehören Streptomycin, Isoniazid usw. Bei Patienten mit klinischer tuberkulöser Pleuritis ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sich Folgeerscheinungen entwickeln. Zu den Folgen einer tuberkulösen Pleuritis zählen endoskopischer Erguss, Pleuraverklebung und -verdickung, Empyem usw. Folgen der tuberkulösen Pleuritis - endoskopischer Erguss Gekammerte Ergüsse sind eine Folge von Pleuraexsudationsergüssen. Ein Pleuraerguss tritt häufig innerhalb der ersten sechs Monate nach der Primärinfektion auf. Der Beginn kann akut oder langsam sein. Zu Beginn kann hohes Fieber auftreten, wobei die Körpertemperatur 38–40 °C erreicht, das nach 1–2 Wochen auf leichtes Fieber abfällt und von Symptomen wie Brustschmerzen, Husten, Kurzatmigkeit, Müdigkeit und Schwäche begleitet wird. Sobald sich die Flüssigkeitsmenge angesammelt hat, verschwinden die Brustschmerzen des Patienten allmählich. Die Untersuchung ergab eine eingeschränkte Atembewegung auf der betroffenen Seite, eine Verlagerung der Luftröhre und des Herzens auf die gegenüberliegende Seite, feste Geräusche bei der Perkussion und verringerte Atemgeräusche bei der Auskultation. Wenn eine Thorakozentese durchgeführt wird, handelt es sich bei dem entnommenen Pleuraerguss meist um strohgelbes Exsudat. Mycobacterium tuberculosis kann im Pleuraerguss gefunden werden, die Positivrate ist jedoch nicht hoch. Auf tangentialen Röntgenaufnahmen erscheint ein gekapselter Erguss oft als halbkreisförmiger oder flacher Schatten, der von der Brustwand in das Lungenfeld hineinragt, mit einem stumpfen Winkel zwischen den oberen und unteren Rändern und der Brustwand, gleichmäßiger Dichte und klaren Rändern. Folgen der tuberkulösen Pleuritis - Pleuraverklebung und -verdickung Eine durch eine tuberkulöse Pleuritis verursachte Pleuraverklebung und -verdickung ist häufig eine Folge einer unsachgemäßen Behandlung eines Pleuraergusses. Einerseits kommt es vor, dass sich das Fibrin im Erguss langsam auf der Pleura ablagert, wenn der Pleuraerguss in der Brust des Patienten nicht umgehend und wirksam behandelt wird, wodurch sich die Pleura allmählich verdickt. Während sich weiterhin Fibrin ablagert, nimmt die Dicke der beiden Pleuraschichten weiter zu, wodurch der Spalt zwischen den beiden Schleimhautschichten allmählich verkleinert wird, bis sie aneinander haften. Kommt es hingegen zu einer Vermehrung von Granulationsgewebe im Pleuraraum, kommt es ebenfalls zu einer kontinuierlichen Verdickung der Pleura, einer Entwicklung in entgegengesetzte Richtungen und schließlich zur Verklebung. Folgen der tuberkulösen Pleuritis - Empyem Bei einem durch eine tuberkulöse Pleuritis verursachten Empyem gibt es zwei verschiedene Erscheinungsformen: das akute Empyem und das chronische Empyem. Patienten mit akutem Empyem leiden unter Schüttelfrost und hohem Fieber mit einem Muster schwankenden Fiebers und Schüttelfrosts sowie Symptomen wie starken Brustschmerzen, Engegefühl in der Brust, Kurzatmigkeit und Husten. Es gibt Anzeichen eines Pleuraergusses im betroffenen Brustkorb und die Haut der Brustwand kann rot, geschwollen, heiß und empfindlich sein. Innerhalb von 2–3 Wochen können auch Trommelschlägelfinger auftreten. Bei routinemäßigen Blutuntersuchungen zeigte sich ein Anstieg der weißen Blutkörperchen, oft über 15×109/l, wobei Neutrophile der Hauptbestandteil waren; Die Röntgenuntersuchung des Brustkorbs zeigte das Vorhandensein eines Pleuraergusses, und die Punktion ergab, dass der Erguss eitrig war. Patienten mit chronischem Empyem weisen ein chronisch krankes Erscheinungsbild, Gewichtsverlust, Blässe, Anämie, anhaltendes Fieber, Trommelschlegelfinger (Zehen) sowie lokale Symptome wie Husten, Auswurf, Kurzatmigkeit, Engegefühl in der Brust, Brustschmerzen, Senkung der Brustwand und eingeschränkte Beweglichkeit auf. Eine Röntgenuntersuchung des Brustkorbs zeigte eine Verdickung des Brustkorbs auf der betroffenen Seite, einen kollabierten Brustkorb, eingeklemmte Rippen und ein angehobenes Zwerchfell. Hieran lassen sich die Folgen einer tuberkulösen Rippenfellentzündung erkennen. Experten weisen Patienten mit tuberkulöser Pleuritis darauf hin, dass die wichtigsten Punkte zur Vorbeugung und Behandlung von Folgeerscheinungen darin bestehen, sich nach der Genesung zunächst eine Zeit lang auszuruhen und dann die Arbeit entsprechend einzuteilen. Zweitens: Führen Sie einen normalen Alltag, vermeiden Sie zu große Müdigkeit und langes Aufbleiben, da sich sonst leicht Symptome der Folgeerscheinungen einer tuberkulösen Pleuritis entwickeln können. Drittens sollten Sie Ihre Stimmung entspannt und fröhlich halten und an mehr kulturellen und unterhaltsamen Aktivitäten teilnehmen, die Ihnen Spaß machen. Viertens: Treiben Sie mehr Sport und achten Sie auf die Kombination von Arbeit und Ruhe. Für Patienten mit einer Rippenfellentzündung eignen sich beispielsweise Qigong, Tai Chi, zügiges Gehen, Joggen usw. Beim Training sollten Ihre Bewegungen leicht und sanft sein und Ihre Atmung natürlich und tief, um übermäßige Krafteinwirkung und eine Überlastung der Pleura zu vermeiden. Wenn Sie während des Trainings Brustschmerzen, Fieber, Husten, Kurzatmigkeit oder andere Beschwerden verspüren, bedeutet das, dass Sie zu viel trainieren und Sie sollten die Trainingsintensität entsprechend reduzieren. Behandlung der Folgen einer Rippenfellentzündung Behandlung mit westlicher Medizin: ① Antibiotikabehandlung A. Medikamentöse Behandlung gegen Tuberkulose: Geeignet zur Behandlung von tuberkulöser trockener oder exsudativer Pleuritis. Isoniazid 300 mg pro Tag oder Rifampicin 1 mg pro Tag oder Ethambutol 0,75–1 g pro Tag, einmal täglich, für 3 aufeinanderfolgende Monate. Streptomycin 0,75–1 g pro Tag, intramuskuläre Injektion, 1–2 Monate, im Wechsel mit oraler Gabe, gesamte Behandlungsdauer 6–9 Monate. B. Nichttuberkulöse Pleuritis: Die geeignete medikamentöse Behandlung sollte entsprechend der Grunderkrankung (wie Infektion, Tumor usw.) ausgewählt werden. C. Patienten mit eitriger Pleuritis oder tuberkulösem Empyem mit Infektion: 1,6–3,2 Millionen Einheiten Penicillin C pro Tag, aufgeteilt auf 4 intramuskuläre Injektionen, und 807 Einheiten können in die Brusthöhle injiziert werden. 2 Schmerzlinderung: Orale Einnahme von 0,6 g Aspirin oder 50 mg Indomethacin, 3-mal täglich, oder 15–30 mg Codein, 3-mal täglich. 3. Thorakozentese: Geeignet für Patienten mit exsudativer Pleuritis mit starkem Pleuraerguss, offensichtlichen Atembeschwerden oder Erguss, der nach einer Langzeitbehandlung nicht resorbiert wird. Die jeweils entnommene Flüssigkeitsmenge sollte 1000 ml, 2-3 Mal pro Woche, nicht überschreiten. ④ Hormontherapie: In Kombination mit Tuberkulosemedikamenten hat sie eine positive therapeutische Wirkung auf die Beseitigung systemischer toxischer Symptome, die Förderung der Ergussabsorption und die Verhinderung einer Verdickung und Verklebung der Pleura. 15–30 mg Prednison können dreimal oral eingenommen werden. Wenn sich die systemischen Symptome bessern und die Absorption des Ergusses deutlich abnimmt, kann die Dosierung schrittweise reduziert werden. Die Einnahme des Medikaments erfolgt in der Regel 4–6 Wochen lang. |
<<: Fünf häufige Symptome einer Frozen Shoulder
>>: Verursacht Osteoporose Schmerzen im ganzen Körper?
Artikel empfehlen
Die verschiedenen Klassen von Frauen im Bett
Frauen sind genauso lustvoll wie Männer und ihr L...
Was ist die Differentialdiagnose einer stenosierenden Sehnenscheidenentzündung?
Welche Methode ist die Differentialdiagnose bei e...
Kann ich Kakis essen, wenn ich Nierensteine habe? Iss etwas
Patienten mit Nierensteinen sollten weniger Kakis...
Kann eine 15 Jahre alte Meniskusverletzung geheilt werden?
Handelt es sich bei einem 15-jährigen Patienten u...
Flirttipps, um Männer gehorsam zu machen
Viele Männer haben im Privaten zum Ausdruck gebra...
Wie entsteht eine Venenentzündung?
Besonders im Winter ist eine Venenentzündung eine...
Wissen Sie, welche Ernährungstabus es nach einer Blinddarmoperation gibt?
Wenn eine Blinddarmentfernung mittels Laparotomie...
Was ist eine pathologische Fraktur?
Unter einer pathologischen Fraktur versteht man e...
Wie man eine akute Pleuritis behandelt, wirksame Methoden zur Behandlung einer akuten Pleuritis
Eine akute Rippenfellentzündung erfordert ausreic...
Was ist das beste Medikament gegen Proktitis?
Es gibt kein einzelnes bestes Medikament zur Beha...
Welche Faktoren verursachen eine Venenentzündung?
Unter Phlebitis, der vollständigen Bezeichnung Th...
Die Diagnose und Behandlung eines Bandscheibenvorfalls in der Lendenwirbelsäule sollte ernst genommen werden!
Die Diagnose und Behandlung eines Bandscheibenvor...
Sprechen Sie über die Arten von Pleuritis
Mit der Entwicklung der Gesellschaft treten im Le...
Welche Gefahren bergen Nierensteine für Männer?
Nierensteine sind eine häufige Steinerkrankung,...
Um Ischias vorzubeugen, achten Sie auf Ihre Ernährungsgewohnheiten
Die Essgewohnheiten werden von Ischiaspatienten o...