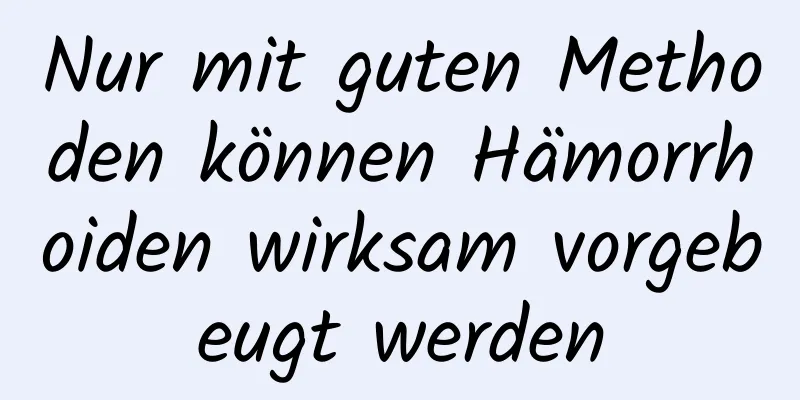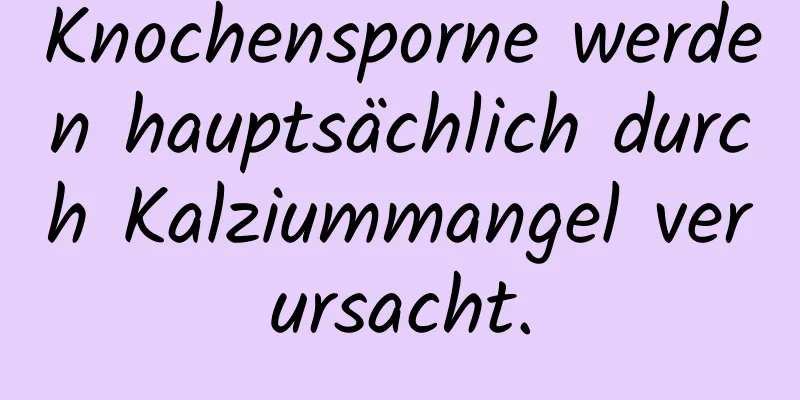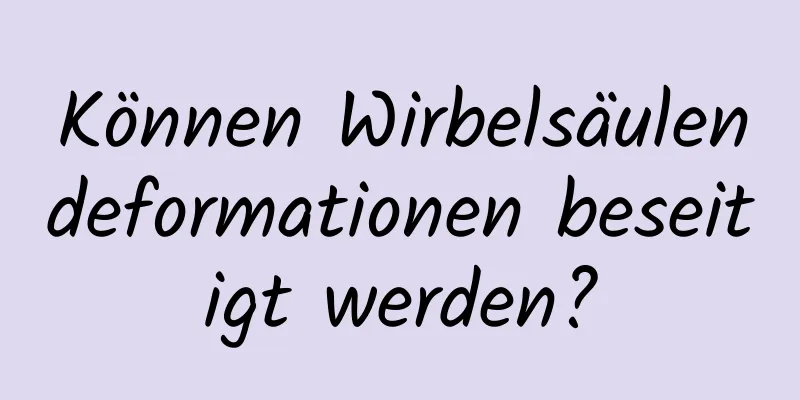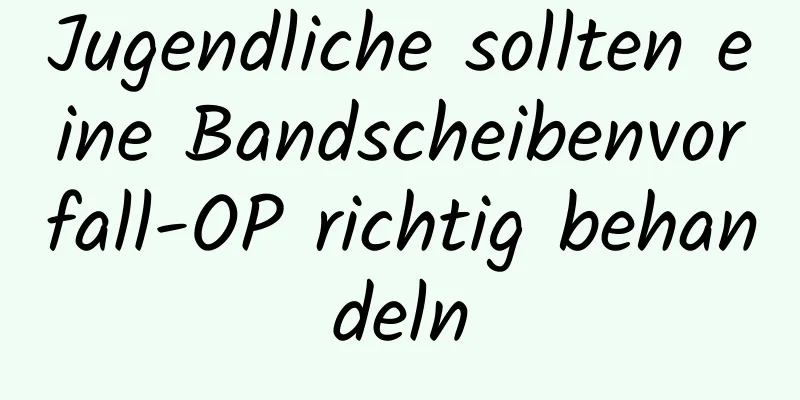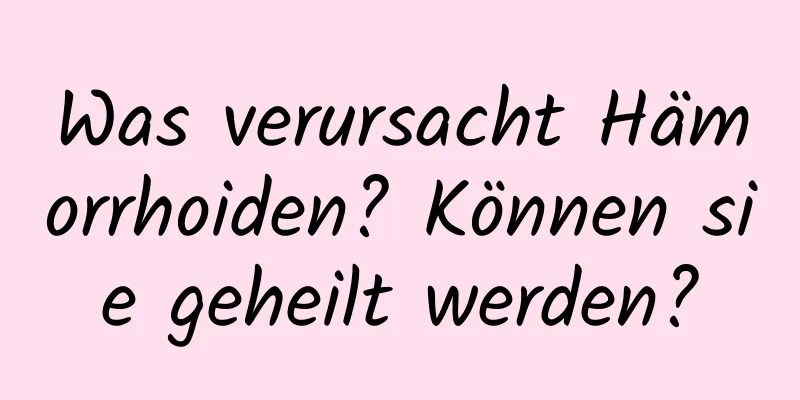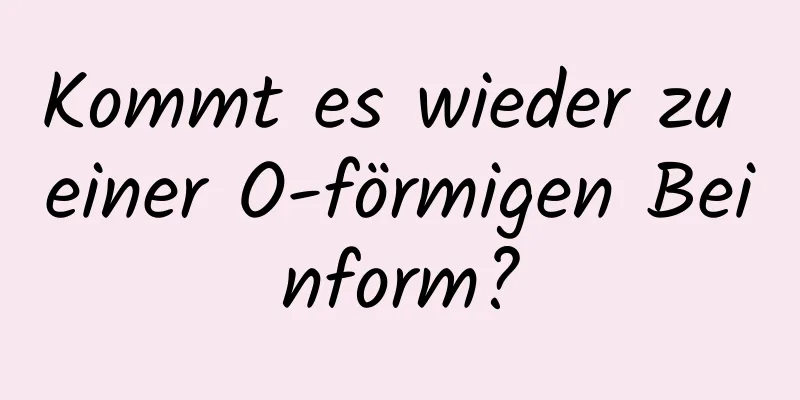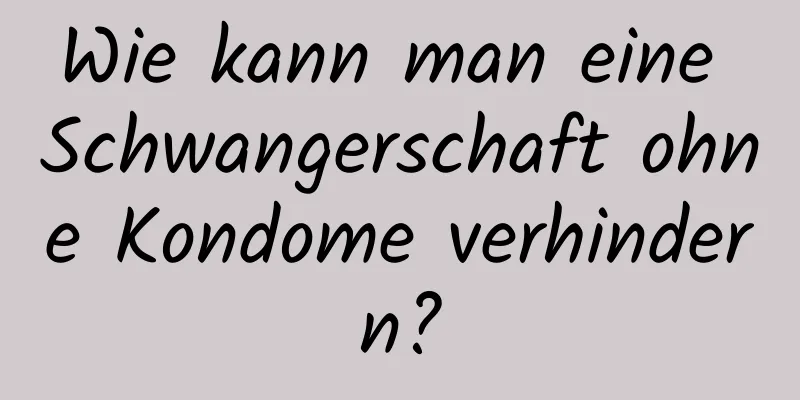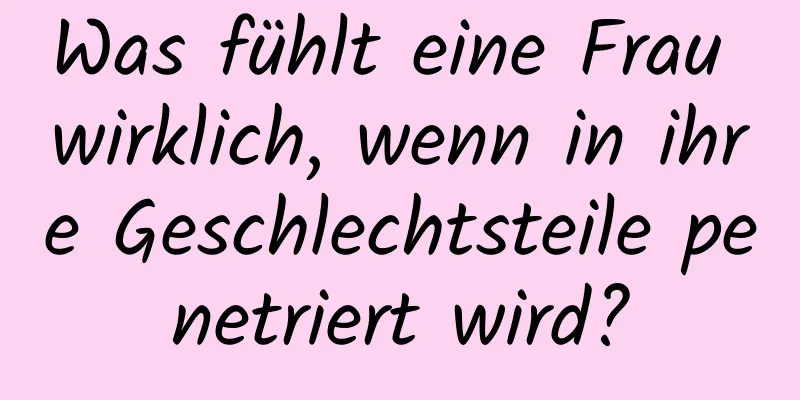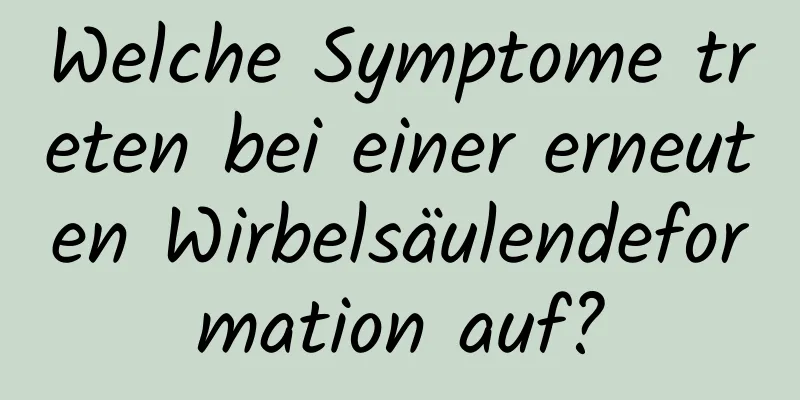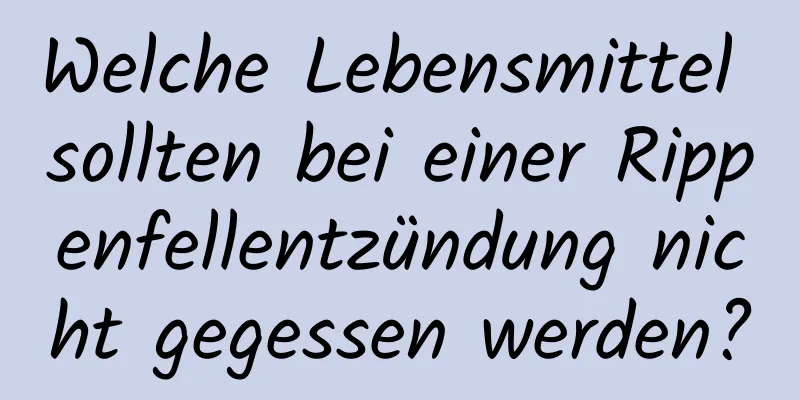So diagnostizieren Sie eine Harnwegsinfektion
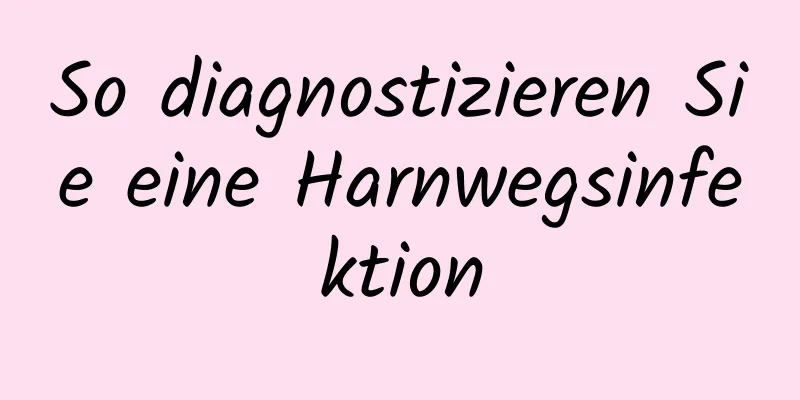
|
Harnwegsinfektionen können je nach Art der Entzündung in akute und chronische Harnwegsinfektionen unterteilt werden. In leichten Fällen treten zu Beginn der Krankheit keine Symptome auf und in der Urinkultur wachsen lediglich Bakterien. In schweren Fällen können Fieber oder kein Temperaturanstieg, Krämpfe oder Magen-Darm-Symptome auftreten. Normalerweise basiert die Diagnose auf klinischen Manifestationen oder wird durch eine Blasenpunktion und Urinkultur bestätigt. 1. Diagnosekriterien für Harnwegsinfektionen (1) Patienten mit einer Leukozytenzahl ≥10/HP im sauberen, zentrifugierten Mittelstrahlurinsediment oder Symptomen einer Harnwegsinfektion. (2) Normaler sauberer Mittelstrahlurin (der Urin muss länger als 4 bis 6 Stunden in der Blase verbleiben) mit quantitativer Bakterienkultur, mit einer Koloniezahl von ≥105/ml. Die Diagnose kann bestätigt werden, wenn die oben genannten Punkte 1 und 2 erfüllt sind. Wenn keine 1 angezeigt wird, sollte die Urinbakterienzählung wiederholt werden. Liegt der Wert weiterhin bei ≥105/ml und sind die Bakterien in beiden Untersuchungen gleich, kann die Diagnose bestätigt werden. (3) Liegt die Urinbakterienzahl zwischen 104 und 5/ml, sollte der Patient erneut untersucht werden. Liegt der Wert immer noch zwischen 104 und 5/ml, sollte die Diagnose in Kombination mit klinischen Manifestationen oder durch eine Blasenpunktion und Urinkultur zur Bestätigung gestellt werden. (4) Eine Urinkultur mittels Blasenpunktion kann bei positivem Bakterienbefund (unabhängig von der Keimzahl) die Diagnose bestätigen. (5) Bei Patienten, die Schwierigkeiten mit der Zählung von Urinbakterien haben, kann vor der Behandlung eine Gram-Färbung des zentrifugierten Urinsediments mit der herkömmlichen Methode am sauberen Mittelstrahlurin (Urin, der länger als 4 bis 6 Stunden in der Blase verbleibt) durchgeführt werden, um nach Bakterien zu suchen. Wenn die Bakterienzahl >1/Ölimmersionsfeld ist und klinische Symptome vorliegen, kann die Diagnose bestätigt werden. 2. Diagnosekriterien für Infektionen der oberen und unteren Harnwege (1) Aufgrund der klinischen Symptome wird bei Patienten mit Fieber (> 38 °C) oder Rückenschmerzen, Schmerzen durch Nierenklopfen oder Leukozytenzylindern im Urin meist eine Pyelonephritis diagnostiziert. (2) Bei Personen mit einem positiven Urintest auf antikörpergekapselte Bakterien wird meist eine Pyelonephritis diagnostiziert, während bei Personen mit einem negativen Test meist eine Blasenentzündung diagnostiziert wird. (3) Bleibt die Niereninsuffizienz auch nach der Behandlung bestehen und können andere Ursachen ausgeschlossen werden oder zeigen sich im Röntgen-Pyelogramm auffällige Veränderungen, so handelt es sich um eine Pyelonephritis. (4) Wenn die Urinprobe nach der Blasensterilisation positiv auf die Bakterienkultur reagiert, handelt es sich um eine Pyelonephritis, während negative Ergebnisse meist auf eine Blasenentzündung hinweisen. (5) Patienten, deren Symptome nach der Behandlung verschwinden, aber einen Rückfall erleiden, leiden meist an einer Pyelonephritis (normalerweise innerhalb von 6 Wochen nach Einnahme des Arzneimittels). Patienten, deren Symptome nach einer einmaligen Antibiotikabehandlung nicht anschlagen oder wiederkehren, leiden meist an einer Pyelonephritis. 3. Diagnosekriterien für wiederkehrende Harnwegsinfektionen (1) Die Symptome verschwinden nach der Behandlung und treten erneut auf, wenn der Urinbakterienbefund negativ wird (normalerweise 6 Wochen nach Absetzen der Medikation). (2) Urinkoloniezahl ≥105/ml. Allerdings ist die Belastung anders als die vorherige. 4. Diagnosekriterien für wiederkehrende Harnwegsinfektionen (1) Bakterienzahl im Urin ≥105/ml. Die Bakterienart ist dieselbe wie beim letzten Mal (die Bakterienart ist dieselbe und derselbe Serotyp, oder das Arzneimittelempfindlichkeitsspektrum ist dasselbe). (2) Nachdem die Symptome verschwunden sind und der Urin keinen Bakterienbefall mehr zeigt, treten sie innerhalb von 6 Wochen erneut auf. 5. Diagnostische Kriterien für das Harnröhrensyndrom (1) Mehrere Urinbakterienkulturen ergaben <105/ml. (2) Die Anzahl der weißen und roten Blutkörperchen im Urin steigt nicht signifikant an (<10/HP). (3) Bei weiblichen Patienten liegt eine offensichtliche Dysurie und häufiges Wasserlassen vor, jedoch keine systemischen Symptome wie Fieber und Leukozytose. Herzliche Erinnerung: Patienten mit chronischer Harnwegsinfektion sollten sich entsprechend ihrem Zustand ausreichend ausruhen, um einer erneuten Infektion aufgrund einer schwachen Immunität nach übermäßiger Ermüdung vorzubeugen. Gleichzeitig sollten sie sich auf die Stärkung ihrer allgemeinen Immunfunktion und die Verbesserung ihrer Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten konzentrieren. Sie können ihre normale Arbeit wieder aufnehmen, nachdem die Symptome vollständig verschwunden sind. |
<<: Was sind die diagnostischen Indikatoren für eine Harnwegsinfektion?
>>: So diagnostizieren Sie eine Harnwegsinfektion
Artikel empfehlen
Eine kurze Diskussion über die tägliche Behandlung von Vaskulitis
Heute sprechen wir kurz über die tägliche Behandl...
Muss eine Pleuraverdickung behandelt werden? Konventionelle Behandlungen bei Pleuraverdickung
In den meisten Fällen ist bei einer Pleuraverdick...
Wie viel kostet die Behandlung einer Kniearthrose?
Bei der Behandlung einer Kniearthrose sind viele ...
Ist die Behandlung innerer Hämorrhoiden teuer?
Was die Kosten der Behandlung innerer Hämorrhoide...
Was sind die frühen Symptome einer Rippenfellentzündung?
Was sind die frühen Symptome einer Rippenfellentz...
Experten erklären, wie Angestellte einer Frozen Shoulder vorbeugen können
Da die Arbeit von Büroangestellten überwiegend ge...
Allgemeines Wissen zur Behandlung von Arthrose
Osteoarthritis ist eine häufige Arthritiserkranku...
Warum bekommen Frauen nach der Geburt Hämorrhoiden? Diättherapie bei postpartalen Hämorrhoiden bei Frauen
Das Auftreten postpartaler Hämorrhoiden kann auf ...
Was verursacht Analleckage? Es gibt drei Möglichkeiten, Anallecks vorzubeugen.
Bei der Analfistel, auch Analfistel genannt, hand...
Kann Knochenhyperplasie geheilt werden?
Wir alle machen diese Erfahrung im Leben. Wir wis...
Experten stellen die Spätsymptome der Spondylitis ankylosans vor
Im Spätstadium kann eine ankylosierende Spondylit...
Welches Volksheilmittel wird zur Behandlung von Knochentuberkulose verwendet?
Knochentuberkulose ist eine bekannte Krankheit. Z...
Stress kann einen Bandscheibenvorfall in der Lendenwirbelsäule verursachen
Mit zunehmendem Lebensdruck breiten sich immer me...
Welche Gefahren bergen Hämorrhoiden, wenn sie längere Zeit nicht behandelt werden?
Welche Gefahren bestehen, wenn Hämorrhoiden über ...
Diät bei Morbus Bechterew
Bei der Behandlung der ankylosierenden Spondyliti...