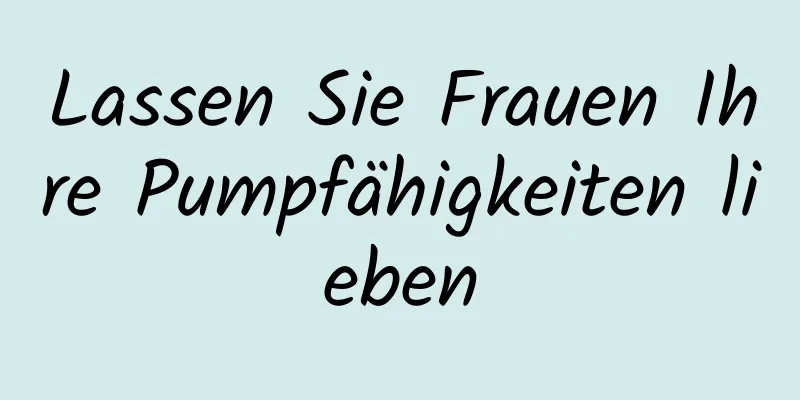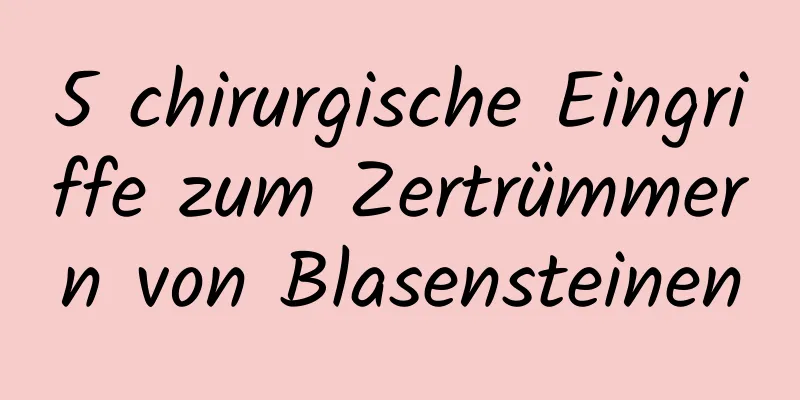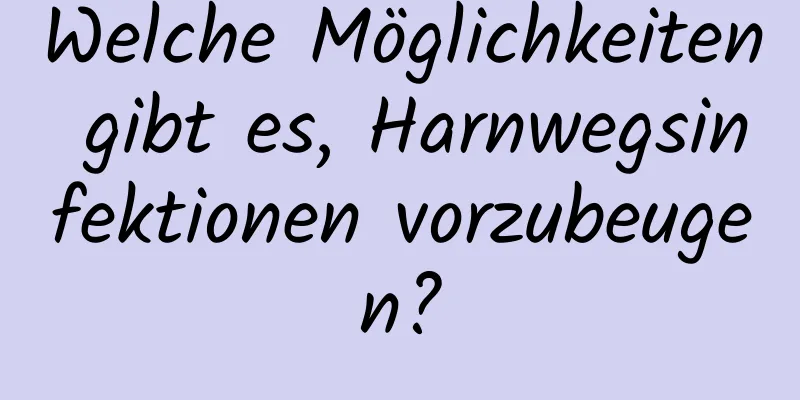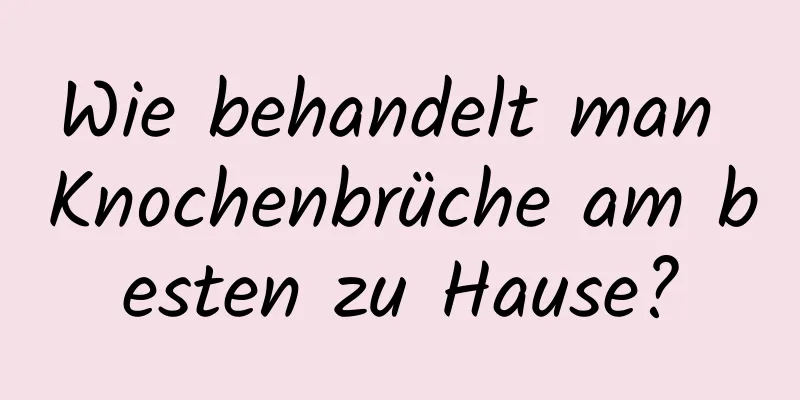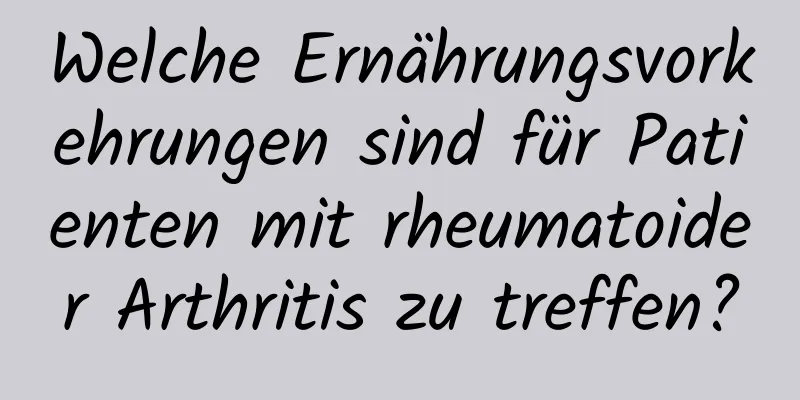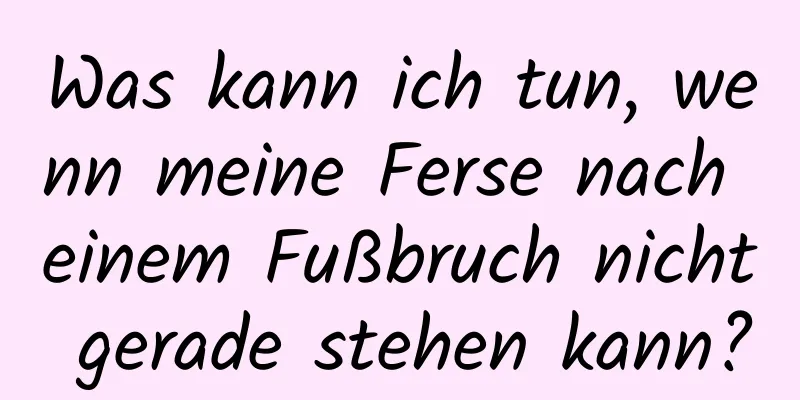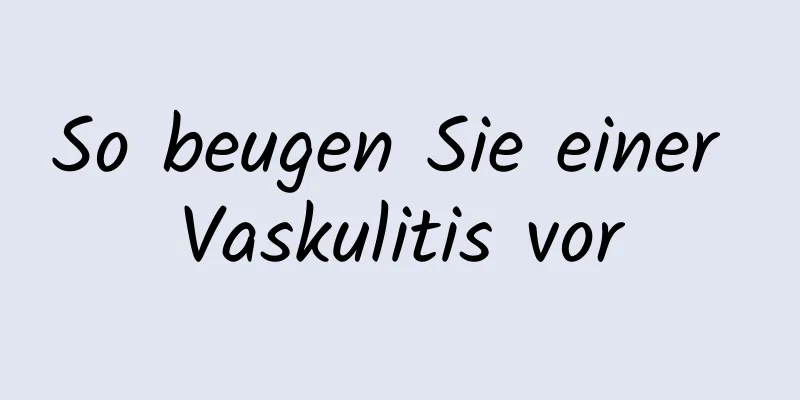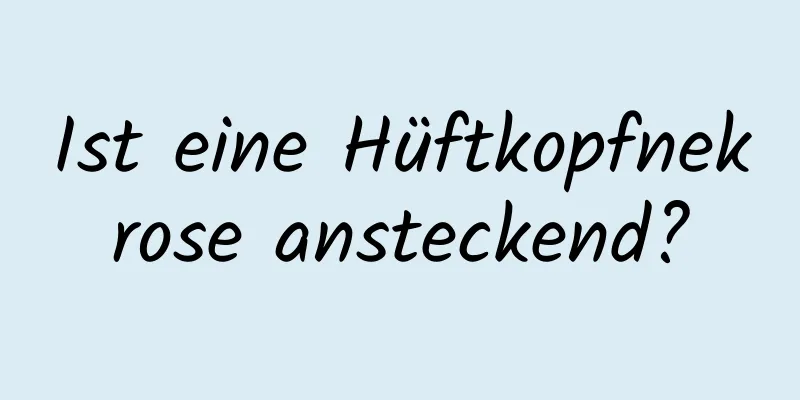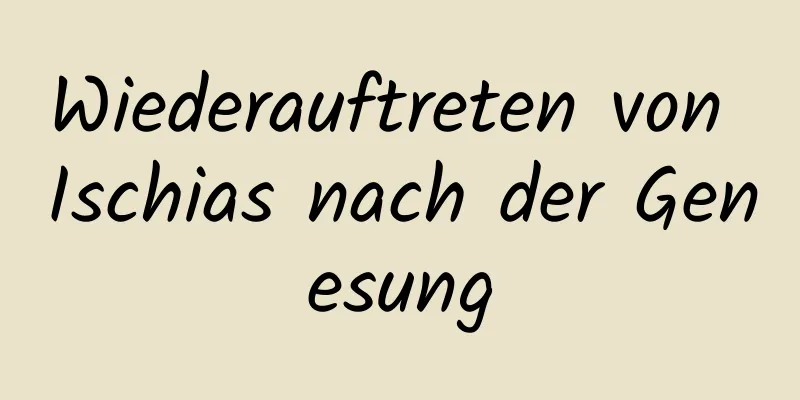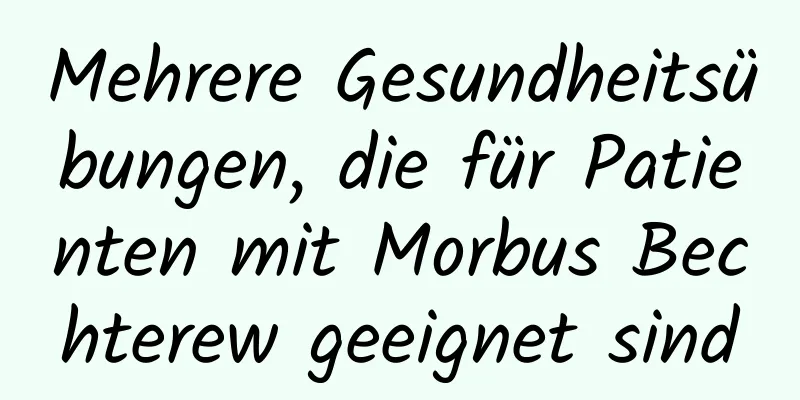Was sind die wichtigsten Untersuchungsgrundlagen bei Darmverschluss?
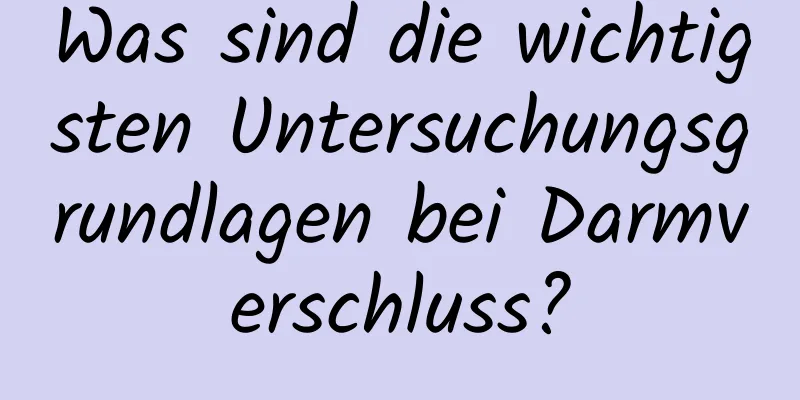
|
Obwohl Darmverschluss ein häufiger Bestandteil unseres Lebens ist, wissen wir nicht viel darüber, insbesondere nicht über die klinischen Symptome. Nachdem Sie die Symptome eines Darmverschlusses verstanden haben, sind auch dessen Untersuchung und Diagnose sehr wichtig. Im Folgenden werden die wichtigsten Untersuchungsgrundlagen bei Darmverschluss vorgestellt. Schauen wir uns zunächst die Symptome eines Darmverschlusses an: 1. Bauchschmerzen: Die meisten Patienten mit Darmverschluss haben Bauchschmerzen. Bei Patienten mit einem akuten kompletten mechanischen Dünndarmverschluss äußern sich die Bauchschmerzen in Form paroxysmaler Koliken, die durch eine starke Peristaltik des Darms oberhalb der Verschlussstelle, die sich meist im mittleren Bauchraum befindet, verursacht werden. Tritt oft plötzlich auf. Steigert sich allmählich bis zu einem Höhepunkt, hält einige Minuten an und lässt dann nach. Die Intervallphase kann völlig schmerzlos sein, kann aber nach einiger Zeit wieder auftreten. Der Grad der Kolik und die Länge der Intervalle variieren je nach Höhe der Obstruktion und Schwere der Erkrankung. 2. Erbrechen: Fast alle Patienten mit Darmverschluss müssen sich übergeben. Im Frühstadium handelt es sich um Reflexerbrechen und das Erbrochene besteht hauptsächlich aus Mageninhalt. Im späteren Stadium kommt es zu Refluxerbrechen, das je nach Ort der Obstruktion unterschiedlich ausfällt. Je höher der Standort, desto häufiger und heftiger das Erbrechen. Bei einem tiefen Dünndarmverschluss ist das Erbrechen milder und seltener. Bei einem Dickdarmverschluss kann es im Frühstadium zu keinem Erbrechen kommen, da die Ileozäkalklappe einen Reflux verhindern kann. Wenn sich die Ileozäkalklappe im späteren Stadium jedoch aufgrund einer Überfüllung der Darmhöhle nicht mehr vollständig schließt, kommt es zu stärkerem Erbrechen und das Erbrochene kann Stuhlsaft enthalten. 3. Blähungen: Blähungen sind ein Symptom, das später auftritt und dessen Ausmaß von der Stelle der Obstruktion abhängt. Ein hoher Dünndarmverschluss verursacht aufgrund des häufigen Erbrechens oft keine offensichtliche Blähungen. Ein tiefer Dünndarmverschluss oder Dickdarmverschluss im Spätstadium führt häufig zu einer erheblichen Blähungen. Bei einem geschlossenen Kreislaufverschluss ist der Darmabschnitt stark aufgebläht, oft mit asymmetrischer lokaler Ausdehnung. Beim paralytischen Ileus ist der gesamte Darmtrakt erweitert und vergrößert, so dass die Bauchblähung erheblich ist. Patienten mit einem einfachen Darmverschluss weisen im Allgemeinen keine offensichtlichen systemischen Symptome auf, doch Patienten mit häufigem Erbrechen und starker Bauchblähung leiden unweigerlich an Dehydration. Menschen mit niedrigem Kaliumspiegel im Blut leiden unter Symptomen wie Müdigkeit, Schläfrigkeit, Schwäche und Herzrhythmusstörungen. Bei Patienten mit eingeklemmtem Darmverschluss treten die stärksten systemischen Symptome auf, wobei es frühzeitig zu einem Kollaps kommt und schnell ein Schockzustand eintritt. Bei Patienten mit einer Bauchinfektion bleiben die Bauchschmerzen bestehen und breiten sich auf den gesamten Bauch aus, begleitet von Schüttelfrost, Fieber, Leukozytose und anderen Symptomen einer Infektion und Toxämie. Die klassischen Anzeichen eines Darmverschlusses treten vor allem im Bauchraum auf. Zur Diagnose eines Darmverschlusses gehört Folgendes: 1. Adhäsiver Darmverschluss (1) Laboruntersuchung: Im Frühstadium einer Obstruktion werden im Allgemeinen keine Auffälligkeiten festgestellt. Zu den Routineuntersuchungen sollten die Anzahl der weißen Blutkörperchen, Hämoglobin, Hämatokrit, Kohlendioxid-Bindungskapazität, Serumkalium, Natrium, Chlorid sowie Routineuntersuchungen von Urin und Stuhl gehören. (2) Zusatzuntersuchung: Röntgenuntersuchung des Abdomens im Stehen: 4 bis 6 Stunden nach Beginn der Obstruktion sind auf der Röntgenaufnahme des Abdomens aufgeblähte Darmschlingen und mehrere Luft-Flüssigkeits-Spiegel zu erkennen. Zeigt sich im Röntgenbild des Bauchraums im Stehen ein fester, kaffeebohnenartiger Gasschatten, sollte man auf das Vorliegen einer Darmstrangulation achten. 2. Strangulierter Darmverschluss (1) Laboruntersuchung: 1. Erhöhte Anzahl weißer Blutkörperchen, Linksverschiebung des Neutrophilenkerns und Hämokonzentration. 2. Metabolische Azidose und Wasser- und Elektrolytungleichgewicht. 3. Erhöhte Kreatinkinase im Serum. (2) Zusatzuntersuchung: Die Röntgenaufnahme des aufrechten Abdomens zeigt fixierte, isolierte Darmschlingen, die die Form von Kaffeebohnen, Pseudotumoren und Blütenblättern haben, und der Darmraum ist erweitert. |
<<: Welche Methoden gibt es, um einen Darmverschluss festzustellen?
>>: Wie lässt sich ein Darmverschluss am besten behandeln?
Artikel empfehlen
Kann ein Vorhofseptumdefekt vollständig geheilt werden?
Kann ein Vorhofseptumdefekt vollständig geheilt w...
Experten erklären Röntgenuntersuchung von Frakturen
Die Röntgenuntersuchung ist derzeit die am häufig...
Eine kluge Frau kann einen Mann nur kontrollieren, wenn sie sich nicht um die drei Dinge kümmert
Behalten Sie einen Mann im Auge, indem Sie ihn ze...
Die Größe des Penis eines Mannes bestimmt tatsächlich seine Fruchtbarkeit
Die Größe der Hoden hängt vom Alter ab. Vom Neuge...
Die 5 wichtigsten Dinge, die Sie über Beziehungen wissen müssen
Um in einer Beziehung glücklich zu sein, benötige...
Bei Männern mit einem zentralen Bandscheibenvorfall in der Lendenwirbelsäule können besondere Symptome auftreten
Bei einem zentralen Bandscheibenvorfall in der Le...
Häufige Ursachen für Knochentuberkulose
Die moderne Medizin geht davon aus, dass Knochen-...
So können Sie Harnleitersteinen durch Ihre Lebensgewohnheiten vorbeugen
Wenn Sie unglücklicherweise an Harnleitersteinen ...
Welches Medikament ist besser für die Nebenbrust
Welches Medikament ist gut für zusätzliche Brüste...
Das Hauptsymptom einer zervikalen Spondylose mit Radikulopathie ist Taubheitsgefühl.
Die zervikale spondylotische Radikulopathie ist e...
Welche Symptome treten im Leben bei Gallenblasenpolypen auf?
Neben den zahlreichen Erkrankungen der Inneren Me...
Die häufigsten Symptome einer ankylosierenden Spondylitis variieren stark in ihrer Schwere
Morbus Bechterew ist eine chronische Entzündungsk...
Älterer Mann erleidet Verbrennungen dritten Grades durch Selbstbehandlung von Hämorrhoiden
Die alte Frau Wu lebt im Bezirk Laishan. Sie lebt...
Was ist die wirksame Behandlung von Plattfüßen?
Plattfüße sind eine orthopädische Erkrankung, zu ...
Kann man eine Brustzyste ertasten?
Brustzysten lassen sich in der Regel durch Abtast...